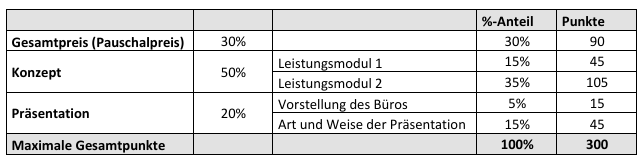OLG Frankfurt zu der Frage der Ermessensentscheidungen gemäß § 56 Abs. 2 VgV über das Nachfordern von Unterlagen
vorgestellt von Thomas Ax
Die Ermessensentscheidung ist von den Nachprüfungsinstanzen nur beschränkt und zwar analog § 114 VwGO daraufhin zu überprüfen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist. Neben einem Ermessensnichtgebrauch (Ermessensausfall) und einer Ermessensüberschreitung kommt dabei – hier allein relevant – ein Ermessensfehlgebrauch in Betracht. Hierher gehören zum einen die Fälle, in denen die Behörde nicht alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt oder nicht alle für die Entscheidung bedeutsamen Tatsachen ermittelt hat. Zum anderen handelt es sich um die Fälle, in denen die Behörde den Zweck der Ermächtigung verkannt hat. Schließlich geht es um die Fälle, in denen die Behörde bewusst aus unsachlichen Motiven gehandelt hat. Ein Ermessensfehlgebrauch führt auch dann zur Rechtswidrigkeit der Ermessensentscheidung, wenn die gewählte Rechtsfolge im Ergebnis auch auf der Grundlage vollständiger und fehlerfreier Ermessenserwägungen hätte angeordnet werden können. Denn beim Ermessensfehlgebrauch geht es um einen Verstoß gegen die “inneren” Grenzen des Ermessens, während die Ermessensüberschreitung die “äußeren” Grenzen des Ermessens betrifft und voraussetzt, dass die angeordnete Rechtsfolge nicht von der Ermessensermächtigung gedeckt ist, im Ergebnis also unabhängig von den zugrunde liegenden Ermessenserwägungen nicht angeordnet werden durfte (BeckOK VwVfG/Aschke, 52. Ed. 1.7.2021, § 40 VwVfG, Rn. 85 f., 87). Bei Ermessensentscheidungen gemäß § 56 Abs. 2 VgV über das Nachfordern von Unterlagen bedarf es der Abschätzung der konkret zu erwartenden Verzögerung und deren Auswirkungen auf das Verfahren. Es ist auch zu berücksichtigen, ob die Vergabestelle diese Auswirkungen durch eine frühere Nachforderung hätte abmildern oder vermeiden können. Bei der Ermessensentscheidung ist es besonders zu berücksichtigen, wenn bei Ausschluss eines Bewerbers nur noch ein einziger Bewerber übrigbleiben wird.
Gründe
I.
Die Antragstellerin wendet sich gegen den Ausschluss ihres Angebots von einem vom Hessischen Competence Center für neue Verwaltungssteuerung (Vergabestelle) des beschwerdeführenden Landes und Antragsgegners durchgeführten Vergabeverfahren, an dem neben ihr nur die Beigeladene beteiligt war. Gegenstand des zuletzt als Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb betriebenen Vergabeverfahrens (Vergabenr. …) ist die “Anmietung einer gasbetriebenen mobilen Brandsimulationsanlage zur Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern inklusive Ausbildung für die hessische Landesfeuerwehrschule”.
Die Vergabekammer hat den Sachverhalt und die bei ihr gestellten Anträge wie folgt festgestellt:
Der Antragsgegner schrieb mit europaweiter Bekanntmachung vom 29. November 2019 im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union unter der Ausschreibungsnummer … die Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern durch Nutzung einer mobilen Brandsimulationsanlage nach DIN 14097 Teil 1 und 2 – Mai 2018 zunächst im offenen Verfahren aus. Unter Ziffer II.2.4) der Auftragsbekanntmachung hieß es wie folgt:
“Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern durch Nutzung einer mobilen Brandsimulationsanlage nach DIN 14097 Teil 1 und 2 -Mai 2018. Das Land Hessen beabsichtigt zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren eine mobile gasbetriebene Brandsimulationsanlage anzumieten. Die Anlage soll in den Jahren 2021 und 2022 für jeweils 15 Wochenangemietet und an wechselnden Standorten jeweils für etwa eine Woche zur Verfügung gestellt werden. Die Ausbildung soll in beiden Jahren im Zeitraum von April bis September durchgeführt werden. Die Betriebszeit pro Woche beträgt 54 Stunden.” (Blatt 116 der Vergabeakte Bd. I).
Hinsichtlich der Teilnahmebedingungen hatten die Bieter im Hinblick auf die Befähigung zur Berufsausübung eine Eigenerklärung bezüglich des Nichtvorliegens einer Vergabesperre vorzulegen. Bezüglich der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit hatte der Antragsgegner keine Anforderungen formuliert. Als Nachweis für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit hatten die Bieter eine Liste mit geeigneten Referenzen der in den letzten drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen mit folgenden Angaben vorzulegen: Art und Umfang, Erbringungszeitpunkt, Angabe des Wertes, öffentlicher oder privater Empfänger mit den jeweiligen Kontaktdaten, wobei Referenzen dann geeignet sind, wenn diese in Art und Umfang dem hier zu vergebenden Auftrag entsprechen (Blatt 114 der Vergabeakte Bd. I).
Antragstellerin und Beigeladene reichten als einzige Bieter jeweils fristgerecht ein Angebot ein. Der Antragsgegner hob mit Schreiben vom 16. März 2020 (Blatt 318 bis 324 der Vergabeakte Bd. I) das Vergabeverfahren gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 VgV in Verbindung mit § 63 Abs. 1 Nr. 3 VgV auf.
Grund hierfür war, dass das Angebot der Beigeladenen erheblich über der Kostenschätzung lag, das Angebot der Antragstellerin der Leistungsbeschreibung nicht entsprach. Gleichzeitig teilte der Antragsgegner den Bietern mit, die ausgeschriebene Leistung solle in einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 VgV vergeben werden.
In der Folgezeit überarbeitete der Antragsgegner die Vergabeunterlagen (Blatt 1 bis 96 der Vergabeakte Bd. I). Unter dem 24. August 2020 (Blatt 102 der Vergabeakte Bd. I) forderte der Antragsgegner nur die beiden im offenen Verfahren beteiligten Bieter, die Antragstellerin und die Beigeladene, zur Abgabe eines Angebotes auf. Beide Bieter reichten bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 21. September 2020 indikative Angebote ein. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2020 forderte der Antragsgegner sowohl die Antragstellerin als auch die Beigeladene zur Preisaufklärung auf, da der jeweilige Angebotspreis die Kostenschätzung des Antragsgegners teilweise um
mehr als 30 % überstieg bzw. um mehr als 20 % unterschritt. Gleichzeitig lud der Antragsgegner in den jeweiligen Schreiben vom 13. Oktober 2020 die beiden Bieter zu einem Verhandlungsgespräch, das jeweils am 28. Oktober 2020 stattfinden sollte, ein. Beide Bieter erhielten jeweils eine individuelle Agenda für den Verhandlungstermin, die ebenfalls mit dem Schreiben vom 13. Oktober 2020 übersandt wurde (Blatt 249 bis 258 der Vergabeakte Bd. II). Diese Agenda enthält folgende Einleitung:
“Gemäß dem “Hinweis zu Verhandlungsrunden” aus der “Ergänzung zur Angebotsaufforderung”, kann sich der Bieter in den Verhandlungsterminen präsentieren und Anregungen zu den Vergabeunterlagen geben. Vor der Aufforderung zur Einreichung der endgültigen Angebote gemäß § 17 Abs. 14 VgV wird der Auftraggeber entscheiden, ob und welche Änderungen er an den Vergabeunterlagen vornimmt und dies den Bietern mitteilen.” (Blatt 256,250 der Vergabeakte Bd. Il).
Ausweislich der Vergabeakte (Blatt 255 bis 256 der Vergabeakte Bd. Il) sollte mit der Antragstellerin vor allen Dingen über den Neubau des von ihr angedachten Brandübungscontainers und des Neubaus bzw. der Neukonzeption des Orientierungsraumes in dem Verhandlungstermin gesprochen werden.
Mit Zusatzschreiben vom 20. September 2020, ihrem Angebot beigefügt, teilte diese mit, im Falle einer Auftragserteilung käme ein neuer Brandübungscontainer zum Einsatz, der gleichermaßen alle in der Ausschreibung geforderten Kriterien erfülle (Blatt 180 der Vergabeakte Bd. II). Zu diesem von der Antragstellerin angedachten neuen Brandübungscontainer lagen aus Sicht des Antragsgegners keine weiteren Informationen vor. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2020 (Blatt 277 bis 278 der Vergabeakte Bd. II) legte die Antragstellerin eine Übersicht ihrer Kalkulation vor, die Beigeladene mit Schreiben vom 19. Oktober 2020 (Blatt 270 bis 272 der Vergabeakte Bd. Il). In dem Verhandlungsgespräch vom 28. Oktober 2020 (Blatt 291 bis 292 der Vergabeakte Bd. II) erläuterte die Antragstellerin, dass der Neubau des Brandübungscontainers durch die Firma B, Stadt1, erfolgen solle. Des Weiteren erläuterte sie mündlich Ideen und verschiedene Möglichkeiten der technischen Umsetzung. Zur technischen Umsetzung des Orientierungsraumes konnte die Antragstellerin aus Sicht des Antragsgegners ebenfalls nur Ideen präsentieren. Hinsichtlich des Logistikkonzeptes gebe es nach Auffassung des Antragsgegners lediglich Vermutungen zu einer möglichen Umsetzung. Nach dem Protokoll des Verhandlungsgespräches soll die Antragstellerin gesagt haben:
“Das muss ich dann noch mal prüfen, ob der Spediteur das leisten kann.” (Blatt 291 der Vergabeakte Bd. II).
Darüber hinaus habe die Antragstellerin mitgeteilt, sie plane mittelfristig wahrscheinlich mit der Firma B zusammenzuarbeiten und gehe deshalb davon aus, für den Neubau des Brandübungscontainers bessere Konditionen als andere Kunden bekommen zu können. Ausweislich des Protokolls zu dem Verhandlungsgespräch (Blatt 291 der Vergabeakte Bd. Il) habe die Antragstellerin zu den Anschaffungskosten auch auf mehrmalige Nachfrage keine Aussage treffen können. Ein neuer Container habe für sie, die Antragstellerin, Vorteile. Sie habe sowieso einen Neubau geplant und alles sei überschaubar.
Aus dem Protokoll des Verhandlungsgespräches mit der Beigeladenen vom 28. Oktober 2020 (Blatt 287 bis 288 der Vergabeakte Bd. Il) geht unter der Überschrift zu 3) – Neubau bzw. Neukonzeption Orientierungsraum – hervor, dass diese einen Bau des Orientierungsraumes plane und einen Bauzeitenplan vorgelegt hat. Zudem resultiere ein hoher Kostenanteil aus dem Bau und der Implementierung der beiden Zusatzcontainer, mit Unterkonstruktion sowie Verbindung (mechanisch und steuerungstechnisch) an den Brandübungscontainer.
Nach dem Verhandlungsgespräch vom 28. Oktober 2020 informierte der Antragsgegner die Antragstellerin nach § 134 Abs. 1 GWB über die Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und teilte ihr mit, den Zuschlag auf das Angebot der Beigeladenen erteilen zu wollen (Blatt 314 bis 316 der Vergabeakte Bd. Il). Zur Begründung führte der Antragsgegner aus, das Angebot der Antragstellerin müsse nach Abschluss der Verhandlungen gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen werden, da das Angebot noch immer unvollständig, aber auch gemäß § 60 Abs. 3 VgV abzulehnen sei (Blatt 315 bis 316 der Vergabeakte Bd. 11).
Mit anwaltlichen Schreiben vom 11. November 2020 rügte die Antragstellerin den Angebotsausschluss und die im November 2020 beabsichtigte Zuschlagserteilung an die Beigeladene (Blatt 331 bis 348 der Vergabeakte Bd. Il). Der Antragsgegner nahm mit Schreiben vom gleichen Tag die ergangene Vorabinformation nach § 134 Abs. 1 GWB zurück (Blatt 408 der Vergabeakte Bd. Il). Mit Schreiben vom 10. Dezember 2020 (Blatt 409 bis 414 der Vergabeakte Bd. Il) half der Antragsgegner der Rüge der Antragstellerin ab, da die Antragstellerin die Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen Angebotes erwarten durfte und setzte das Verhandlungsverfahren in den Zeitpunkt vor Abschluss der Verhandlungen zurück. Die Bieter sollten unter Einbeziehung der sich aus den Verhandlungsgesprächen vom 28. Oktober 2020 ergeben – den Erkenntnissen zu einem finalen Angebot aufgefordert werden. Die Vergabeunterlagen sollten insoweit eine Anpassung erfahren. Sowohl die bisher geltenden Mindestanforderungen als auch die Zuschlagskriterien sollten unverändert fortgelten. Die Einreichung eines neuen, endgültigen (modifizierten) Angebotes sei erforderlich, zuvor eingereichte Angebote seien erloschen. Hierbei soll es sich sodann um das endgültige (finale) Angebot handeln. Die endgültigen Angebote seien auch nicht mehr nachverhandelbar.
In der Folgezeit überarbeitete der Antragsgegner die Vergabeunterlagen. Ausweislich der “Ergänzung zur Angebotsaufforderung” (Version 2) und dort Ziffer 2.3 ff. sind Unterlagen aufgeführt, die vollständig – soweit erforderlich – ausgefüllt mit dem elektronischen Angebot einzureichen sind (Blatt 521 der Vergabeakte Bd. Il). Die Ziffern 2.3.3 (Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentgelt), 2.3.4 (Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen) und 2.3.5 (Erklärung über die Unternehmensdaten) werden wie folgt eingeleitet: “Entfällt/liegt mit Erstangebot schon vor…” (Blatt 520 bis 521
der Vergabeakte Bd. II). Bei den Ziffern 2.3.3 und 2.3.4 findet sich der Zusatz, dass bei geplantem Einsatz von Unterauftragnehmern diese durch den Bieter zusätzlich von jedem Unterauftragnehmer einzureichen sind, bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft (Blatt 520 bis 521 der Vergabeakte Bd. Il). Bei geplanten Einsatz von Nachunternehmern (Blatt 518 der Vergabeakte Bd. Il) ist gemäß Ziffer 2.3.31 ein Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer vorzulegen, die Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle (2.3.32, Blatt 518 der Vergabeakte Bd. Il). Darüber hinaus seien bei geplantem Einsatz von Nachunternehmern die Ziffern 2.3.3, 2.3.4 und 4 zu beachten (Blatt 518 der Vergabeakten Bd. II). Gemäß Ziffer 3.2 (Blatt 518 der Vergabeakte) erfolgt die Nachforderung, Vervollständigung, Berichtigung von Unterlagen bzw. Aufklärung in diesem Ausschreibungsverfahren, sofern dies vergaberechtlich zulässig und geboten ist. Unter Ziffer 7 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung (Blatt 515 der Vergabeakte Bd. II) wird den Bietern mitgeteilt, dass mit der hier ergehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes die Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen Angebotes nach Maßgabe dieser Vergabeunterlage ergehe. Die endgültigen Angebote seien nicht mehr nachverhandelbar. Die im Laufe des Verfahrens zuvor eingereichten Angebote seien erloschen und die Möglichkeit eines Rückgriffs auf vorangegangene Angebote bestünde nicht. Ausgenommen hiervon seien
die vorstehenden Ziffern 2.3.3, 2.3.4 und 2.3.5.
Nach der Leistungsbeschreibung unter Ziffer 1. “Allgemeines” (Blatt 482 der Vergabeakte Bd. II) beabsichtigt der Antragsgegner zur Ausbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren eine mobile gasbetriebene Brandsimulationsanlage anzumieten. Die Anlage soll in den Jahren 2022 und 2023 für jeweils 15 Wochen angemietet und an wechselnden Standorten jeweils für etwa eine Woche zur Verfügung gestellt werden. Die Betriebszeit pro Woche beträgt 54 Stunden.
Die Anlage soll durch den Bieter an die von der zuständigen Behörde vorgesehenen Stellen transportiert und dort von den Mitarbeitern des Auftragnehmers bedient werden. Eine autarke Versorgung der Anlage mit Betriebsmitteln durch den Bieter ist erforderlich. Die gasbetriebene Brandsimulationsanlage soll durch ein zusätzliches Übungsobjekt erweitert und mit diesem baulich verbunden werden. Im Vorfeld der Ausbildung ist es notwendig, vom Auftraggeber benannte Personen zu Multiplikatoren auszubilden. Diese sollen den Bieter beim späteren Betrieb der Anlage unterstützen und die Ausbildung der örtlichen Atemschutzausbilder durchführen. Alle organisatorischen Belange liegen im Verantwortungsbereich der zuständigen Behörde. Der Preis für die bereitgestellte Brandsimulationsanlage muss als Stundenpreis, für tatsächlich geleistete Stunden, inklusive aller geforderten Leistungen, angegeben werden. Ausweislich der Leistungsbeschreibung unter Ziffer 2.1.”Technische Anforderungen” (Blatt 481 der Vergabeakte Bd. Il) kann mit den finalen Angeboten optional eine Brandsimulationsanlage angeboten werden, die noch nicht nach der geforderten Art vorhanden ist, was bislang so noch nicht in den Vergabeunterlagen formuliert war. Nach Ziffer 2.2 “Organisatorische Anforderungen” der Leistungsbeschreibung (Blatt 477 der Vergabeakte Bd. Il) haben eventuell erforderliche Wartungsarbeiten außerhalb der Betriebszeiten durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Weitere Anforderungen an die Wartungsarbeiten lassen sich den Vergabeunterlagen nicht entnehmen.
Der Transport der Brandsimulationsanlagen sowie des Orientierungsraumes zu den verschiedenen Veranstaltungsorten hat durch den Auftragnehmer nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde in eigener Regie und auf eigene Kosten zu erfolgen. Weitere Anforderungen an den Transport der Brandsimulationsanlage sowie des Orientierungsraumes sind in den Vergabeunterlagen nicht enthalten, auch finden sich im Leistungsverzeichnis hierzu keinerlei Angaben bzw. Preispositionen.
Hinsichtlich der Organisation der Ausbildung (Ziffer 3.1 der Leistungsbeschreibung, Blatt 476 der Vergabeakte Bd. Il) muss das vom Auftragnehmer eingesetzte Bedienpersonal die Anlage in Absprache mit den vor Ort gestellten Ausbildern bedienen, in die besonderen Gefahren der Anlage eingewiesen sein sowie lebensrettende Sofortmaßnahmen sicher beherrschen. Die Qualifikation des Bedienpersonales ist nachzuweisen. Der Nachweis über die Ausbildung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen darf bei der Durchführung der Ausbildung nicht älter als 12 Monate sein.
Die vom Auftraggeber benannten Multiplikatoren sind durch den Auftragnehmer so zu unterweisen, dass diese beim Betrieb der Anlage unterstützend tätig werden können. Im Leistungsverzeichnis finden sich hinsichtlich der Preiskalkulation noch die Angaben, dass hierin auch 2 Multiplikatoren-Schulungen an der an der Hessischen Landesfeuerwehrschule und Abstimmungstermine zur Festlegung der Ausbildungsinhalte enthalten sein müssen.
Am 4. Januar 2021 forderte der Antragsgegner die Bieter zur finalen Angebotsabgabe auf (Blatt 530 der Vergabeakte Bd. Il). Die zunächst systembedingte fehlerhafte Angabe der Angebotsabgabe auf den 12. Januar 2021 korrigierte der Antragsgegner auf den 19. Januar 2021, 12:00 Uhr. Aufgrund der Rüge der Antragstellerin vom 14. Januar 2021, die Angebotsfrist für das finale Angebot sei zu kurz bestimmt und nicht angemessen, verlängerte der Antragsgegner die Angebotsfrist auf den 2. Februar 2021, 12:00 Uhr. Die Beigeladene rügte die Verlängerung der Angebotsfrist mit Schreiben vom 21. Januar 2021 und forderte die Rücknahme der Verlängerung der Angebotsfrist, wobei der Antragsgegner dieser Rüge mit Schreiben vom 22. Januar 2021 nicht abhalf.
Die Antragstellerin reichte am 2. Februar 2021 ihr Angebot ein. In dem beigefügten Schreiben vom 13. Januar 2021 (Blatt 777 bis 778 der Vergabeakte Bd. Il) nimmt sie Bezug auf das im Oktober erfolgte Verhandlungsgespräch und die Kosten einer neuen Brandsimulationsanlage, was sie weiter ausführt. Des Weiteren teilte sie mit, die Erhöhung des Stundenpreises komme insbesondere auch durch die Ausführung aller Arbeiten durch die Firma B GmbH zustande. Darüber hinaus fügte sie ihr Ausbildungskonzept bei (Blatt 719 bis 776 der Vergabeakte Bd. Il). Ebenfalls mit dem Angebot legte sie, so wie in den Vergabeunterlagen verlangt, eine Liste der notwendigen Einzelgewerke und der ausführenden Firmen gemäß Ziffer 2.3.13 in Verbindung mit 2.1.2 der Leistungsbeschreibung für den Fall, dass die Brandsimulationsanlage noch nicht in der geforderten Art vorhanden sein sollte, vor (Blatt 481 und 520 der Vergabeakte Bd. Il).
Die Antragstellerin legte ihrem Angebot auch ein Schreiben vom 10. Januar 2021 bei, indem sie ausführt, dass das Bedienpersonal durch den Hersteller der Brandsimulationsanlage umfassend geschult werde, um neben der Möglichkeit, die Anlage korrekt bedienen zu können, auch ein umfassendes technisches Verständnis zu vermitteln. Dies gelte auch für alle sicherheitsrelevanten Belange. Dadurch werde das Bedienpersonal auch in die Lage versetzt, kleinere Reparaturen, wie das Wechseln von Zündkerzen oder Temperatursensoren, selbstständig ohne Hinzuziehung eines Servicemonteurs durchführen zu können. Darüber hinaus werde das Bedienpersonal regelmäßig vom Betreiber der Anlage geschult. Es sei auch in Erster Hilfe ausgebildet (Blatt 717 bis 718 der Vergabeakte Bd. Il).
Die Beigeladene und Zuschlagsprätendentin reichte mit ihrem Angebot unter anderem das Formblatt 235 (Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird, Blatt 1066 der Vergabeakte Bd. Il) ein, in welchem sie angab, sich hinsichtlich Transport, Aufbau und Inbetriebnahme der Brandübungsanlage am jeweiligen Standort und der trainingsbegleitenden Bedienung der Brandübungsanlange der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen zu wollen. Gleichzeitig benannte sie ausführende Firmen für die Durchführung notwendiger Einzelgewerke (Blatt 816 der Vergabeakte Bd. Il).
Ausweislich der Vergabeakte (Blatt 1.126 der Vergabeakte Bd. Il) entschied sich der Antragsgegner aufgrund des schwierigen Verfahrensverlaufes dazu, einen Fachanwalt für Vergaberecht hinzuzuziehen. Dieser wurde anschließend beauftragt, aufgrund seiner bisherigen Einschätzung den notwendigen Vergabevermerk zu formulieren. Dieser sollte dann umgehend an die Vergabestelle weitergeleitet und umgesetzt werden (Blatt 1.125 der Vergabeakte Bd. Il). Ausweislich dieses fachanwaltlich gefertigten Vergabevermerkes ohne Datum (Blatt 1.115 bis 1.124 der Vergabeakte Bd. Il) hat die Beigeladene ihrem finalen Angebot die Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentgelt, Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen und die Erklärung Unternehmensdaten nicht beigefügt, was jedoch unschädlich sei, da sie sie bereits im offenen Verfahren bzw. mit dem indikativen Angebot diese Unterlagen vorgelegt habe und auch eine Firma als Unterauftragnehmer für die Leistungsbereiche Logistik und Bedienung angegeben habe (Blatt 1.123 der Vergabeakte Bd. Il).
Des Weiteren finden sich auf Seite 1.122 der Vergabeakte Bd. II in diesem Vergabevermerk folgende Ausführungen zu dem Angebot der Beigeladenen:
“Da die Anlage inklusive des weiteren Übungsobjektes (Orientierungsraum) noch nicht in geforderter Art vorhanden ist, legt der Bieter, wie unter Ziffer 2.3.13 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung gefordert, technische Zeichnungen entsprechend En ISO 7200 /ISO 128/ ISO 5455, den Fertigungszeitplan vom Rohbau bis zur Abnahme durch einen Sachverständigen (Bauzeitenplan im Ausbildungskonzept vorgelegt) sowie die Namen der Unternehmen vor, die die notwendigen Einzelgewerke ausführen. Da es sich bei den Unternehmen, die den Orientierungsraum als Anbau für die bereits bestehende Brandsimulationsanlage des Bieters herstellen lediglich um Lieferanten und nicht um Unterauftragnehmern handelt, waren die Unternehmen […] nicht als Unterauftragnehmer zu benennen.”
Hinsichtlich des Angebotes der Antragstellerin wird in dem fachanwaltlichen Vergabevermerk ausgeführt, dass der Bieter mit dem finalen Angebot erstmals angab, dass die “Ausführung aller Arbeiten durch die B GmbH” erfolgen solle, er also ein Unterauftragnehmer nach § 36 VgV einsetzen wolle und sodann mit seinem Angebot das Formblatt 235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen), die Verpflichtungserklärung Mindestentgelt/Tariftreue für Unterauftragnehmern sowie die Erklärung betreffend den Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen für Unterauftragnehmern (Fa. B GmbH) hätte vorlegen müssen. Diese Unterlagen/Erklärungen fehlten jedoch in dem finalen Angebot (Blatt 1.120 der Vergabeakte Bd. Il). Des Weiteren findet sich auf Blatt 1.120 der Vergabeakte Bd. Il folgender Absatz in dem Vergabevermerk:
“Da die Anlage inklusive des weiteren Übungsobjektes (Orientierungsraum) noch nicht in geforderter Art vorhanden ist, legt der Bieter, wie unter Ziffer 2.3.13 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung gefordert, technische Zeichnungen entsprechend En ISO 7200 /ISO 128/ ISO 5455, den Fertigungszeitplan vom Rohbau bis zur Abnahme durch einen Sachverständigen vor. Weiterhin wird der Name des Unternehmens angegeben, dass die notwendigen Einzelgewerke ausführen soll (Fa. B GmbH).”
Mit Vorabinformationsschreiben nach § 134 GWB vom 26. März 2021 (Blatt 1.132 bis 1.136 der Vergabeakte II) teilte der Antragsgegner der Antragstellerin mit, sie sei gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV vom weiteren Verfahren auszuschließen. Der Antragsgegner führte unter anderem aus, gemäß §§ 122 Abs. 1, 2 GWB in Verbindung mit § 17 Abs. 5 VgV könnten in einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb dabei überhaupt nur solche Bewerber zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, die aufgrund der notwendigen Fachkunde und Leistungsfähigkeit die erforderliche Eignung aufwiesen. Maßstab für die Auswahl der aufzufordern Unternehmen zur Abgabe der Angebote sei im Verhandlungsverfahren dabei die bereits zuvor im aufgehobenen offenen Verfahren (…) festgestellte Eignung. Insoweit prüfe der Auftraggeber die erforderliche Eignung der Bewerber/Bieter nicht lediglich einmal, sondern fortlaufend. Diese müsse mithin im gesamten Vergabeverfahren gegeben sein. Insbesondere stünde es dem Auftraggeber zu, im Falle von nachträglichen Zweifeln an der Eignung des Bewerbers/Bieters nach den §§ 42ff. VgV erneut die Eignung des Bewerbers/Bieters zu prüfen. Weil die Antragstellerin mit dem finalen Angebot erstmalig angegeben habe, die Ausführung aller Arbeiten solle nunmehr ausschließlich durch die Firma B GmbH erfolgen, und sie weder das erforderliche Formblatt 235 EU noch die für unter Auftragnehmer erforderliche Verpflichtungserklärung “Mindestentgelt/Tariftreue oder die ebenfalls für jeden Unterauftragnehmer zwingend erforderliche Erklärung “Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen” mit dem finalen Angebot nicht beigefügt habe, bestünden ernsthaft Zweifel an der Fachkunde und Leistungsfähigkeit der Antragstellerin, sodass von der erforderlichen Eignung nichtmehr ohne weiteres ausgegangen werden könne (Blatt 1.133 bis 1.134 der Vergabeakte Bd. II). Eine Nachforderung der fehlenden Unterlagen gemäß § 56 Abs. 2 VgV sei vorliegend weder geboten noch erforderlich, denn nach Ausübung des Ermessens unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit würde eine Nachforderung zu einer weiteren, unzumutbaren Verzögerung des Vergabeverfahrens führen. Darüber hinaus habe er, der Antragsgegner, auf Bitten der Antragstellerin die Angebots- und Ausschlussfrist zur Abgabe der finalen Angebote bereits um zehn Kalendertage verlängert. Insoweit würde eine entsprechende Nachforderung auch zu einer Besserstellung der Antragstellerin und damit zu einer unzulässigen Diskriminierung anderer Verfahrensteilnehmer führen (Blatt 1.133 der Vergabeakte Bd. Il).
Mit anwaltlichen Schreiben vom 30. März 2021 rügte die Antragstellerin ihren Ausschluss aus dem Vergabeverfahren (Blatt 1.145 bis 1.152 der Vergabeakte Bd. Il). Zum einen sei das Unternehmen B GmbH kein Nachunternehmer der Antragstellerin, vielmehr sei es lediglich damit beauftragt, die bereitzustellenden Komponenten zu fertigen. In dem vom Antragsgegner zitierten Anschreiben ging es um die Erläuterung des nunmehr erhöhten Angebotspreises. Die Anmerkung “Ausführung aller Arbeiten durch die Firma B GmbH” beziehe sich ausschließlich auf die Fertigung der gesamten Anlage und ausdrücklich nicht auf die zu erbringende Leistung gemäß der Ausschreibung, die die Bereitstellung und den Betrieb des Brandübungscontainers nebst Orientierungsraumes vorsehe. Insofern sei die Einreichung der Unterlage 235 EU überhaupt nicht erforderlich gewesen. Im Übrigen habe es dem Auftraggeber oblegen, dieses vermeintliche Missverständnis aufzuklären. Dies gelte vor allem deshalb, weil ein Ausschluss eines Angebotes regelmäßig nur das “letzte Mittel” sei. Darüber hinaus sei ein Ausschluss nach § 56 Abs. 2 GWB regelmäßig die Ausnahme und nicht die Regel. Der Antragsgegner habe hier gemäß § 56 Abs. 2 Satz 2 GWB in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen nicht festgelegt, dass er keine Unterlagen nachfordern werde.
Mit Schreiben vom 1. April 2021 (Blatt 1.183 bis 1.194 der Vergabeakte Bd. II) teilte der Antragsgegner mit, der Rüge nicht abzuhelfen, da die Firma B GmbH Unterauftragnehmer sei, das finale Angebot der Antragstellerin im Sinne von § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV nicht alle geforderten Unterlagen enthalte und keine Nachforderungspflicht bestehe.
Mit anwaltlichen Schreiben vom 1. April 2021 beantragte die Antragstellerin die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Zur Begründung nimmt sie zunächst im wesentlichen Rückgriff auf ihr Rügeschreiben vom 30. März 2021. Die Leistung des Unternehmens B GmbH stelle eine reine Zuliefererleistung dar. Die Antragstellerin habe eine neue Brandsimulationsanlage in Auftrag gegeben die unter anderem auch im Rahmen der hier ausgeschriebenen Leistung zum Einsatz kommen solle. Eingesetzt werde diese neue Brandsimulationsanlage von der Antragstellerin selbst.
Wesentlicher Vertragsbestandteil sei die Anmietung und Gestellung der Brandsimulationsanlage in den Jahren 2022 und 2023 für jeweils 15 Wochen und die Bereitstellung der Anlage an verschiedenen Standorten einschließlich ihres Betriebes durch Mitarbeiter des Auftragnehmers.
Die Antragstellerin erwerbe die Brandsimulationsanlage von dem Unternehmen B GmbH, sodass es sich insoweit um eine bloße Hersteller- bzw. Zulieferleistung handele.
Auch die Tatsache, dass der Hersteller bei Auslieferung bzw. vor Erstinbetriebnahme eine umfassende Schulung des Bedienpersonales, also des Personals der Antragstellerin, vornehme, führe auch nicht zu einer Nachunternehmerschaft. Diese Vorgehensweise sei nicht ungewöhnlich, denn gerade bei Spezialmaschinen und Spezialfahrzeugen, die besondere Kenntnisse bei deren Einsatz fordern, sei es Gang und Gäbe, dass das hierauf eingesetzte Personal häufig auch vom Hersteller besonders geschult und eingewiesen werde.
Auch der Transport der Anlage werde von der Antragstellerin selber vorgenommen. Das Unternehmen B GmbH sei und bliebe lediglich Hersteller der neuen Anlage und nicht mehr. Dass die Brandsimulationsanlage regelmäßig, so wie auch gesetzlich vorgesehen, durch das Unternehmen B GmbH gewartet und geprüft werde, führe ebenfalls nicht zu einem Unterauftrag, denn diese Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Anlage selbst hätten nichts mit der ausgeschriebenen Leistung im engeren Sinne zu tun.
Die Antragstellerin beantragt,
- den Antragsgegner zu verpflichten, den Zuschlag unter Berücksichtigung des Angebotes der Antragstellerin zu erteilen;
- der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakten zu gewähren.
Der Antragsgegner beantragt,
den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen.
Er ist der Auffassung, bei der Firma B GmbH handle es sich um einen Unterauftragnehmer im Sinne des § 36 VgV. Da sich die Antragstellerin in ihrem finalen Angebot eindeutig auf die Einbindung einer Unterauftragnehmerin festgelegt habe, habe sie das Formularschreiben “235” ausfüllen müssen. Weiterhin fehlten die Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentgelt und die Erklärung betreffend “Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen”. Nach objektiver Auslegung des Angebotes der Antragstellerin wolle diese alle ausgeschriebenen Leistungen durch die Firma B GmbH ausführen lassen. Aus der Leistungsbeschreibung ergebe sich, dass neben der Anmietung einer mobilen Brandschutzsimulationsanlage, diese Anlage an verschiedenen Standorten der Feuerwehr des Antragsgegners auf- und abzubauen sei. Hierbei handele es sich nicht lediglich um Hilfs- oder Lieferleistungen, sondern um eine Leistung, bei der der werkvertragliche Erfolg geschuldet sei und die eindeutig Bestandteil der ausschreibungsgegenständlichen Leistung sei.
Zudem ergäben sich aus der Leistungsbeschreibung weitere Leistungen, die zu erbringen seien. So seien im Vorfeld der Ausbildung vom Auftraggeber benannte Personen zu Multiplikatoren vom Auftragnehmer auszubilden. Überdies sei die Anlage von Mitarbeitern des Auftragnehmers zu den zuständigen Behörden/Dienststellen des Auftraggebers zu transportieren und zu bedienen. Weiterhin sei die zu liefernde Anlage vom Auftragnehmer mit den erforderlichen Betriebsmitteln zu versorgen. Auch die Wartung der Anlage falle in den Aufgabenbereich des Auftragnehmers. Überdies sei der Preis der Anlage als Stundenpreis, “inklusive aller geforderter Leistungen” von den Bietern anzugeben gewesen. Eine Nachforderungspflicht aus § 56 Abs. 2 VgV ergebe sich nicht. Vielmehr habe der Antragsgegner ermessensfehlerfrei entschieden, von einer Nachforderung abzusehen.
Außerdem sei ein Ausschluss des Angebotes der Antragstellerin auch nach § 57 Abs. 1 Nr. 3 VgV gerechtfertigt, weil ihr Angebot nicht nur vollständig, sondern auch inhaltlich zweifelsfrei sein müsse, was dieses aber nicht sei. Eine Aufklärung habe nicht stattzufinden. Gleiches gelte auch für eine Nachforderung nach § 56 Abs. 2 VgV.
Im Übrigen seien auch die vorhergehenden Angebote aus dem Verhandlungsverfahren nicht erloschen. Die Mitteilung des Antragsgegners habe sich eindeutig auf die Angebote im offenen Verfahren bezogen.
Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. Sie ist der Auffassung, die Antragstellerin habe mit ihrem finalen Angebot vom 2. Februar 2021 klar und unmissverständlich erklärt, dass die Ausführung der gegenständlichen Leistungen nicht durch sie selbst, sondern durch die B GmbH erfolgen solle. Die widersprüchlichen Angaben der Antragstellerin im Nachprüfungsverfahren würden sich nicht mit den Angaben in ihrem Angebot decken. Diese Widersprüchlichkeiten ließen sich auch nicht mit den tatsächlichen Unternehmensverhältnissen der Antragstellerin in Einklang bringen. Sie verfüge ausweislich der eingeholten Creditreform-Auskunft über nur einen Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von ca. 80.000 € und einer Bilanzsumme von ca. 50.000 €. Es handele sich um ein Einmann-Unternehmen des alleinigen Gesellschafters und Geschäftsführers C.
Zu dem Auftragsgegenstand gehöre nicht nur die Vermietung der Brandsimulationsanlage, sondern auch die Ausbildung für die Hessische Landesfeuerwehrschule. Die Antragstellerin könne den gegenständlichen Auftrag vertragsgemäß nicht mit eigenem Personal ausführen. Sie könne ohne Einsatz eines weiteren Unternehmens weder den Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit noch den Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit erbringen. Angebote mit mehrdeutigen Angaben, mit Mehrdeutigkeiten und Widersprüchen führten zum Angebotsausschluss. Die von der Antragstellerin erzeugten Widersprüche ließen sich nicht ohne weiteres aufklären, sodass dieses “non liquet” zu ihren Lasten ginge. Im Übrigen nimmt die Vergabekammer Bezug auf den Schriftsatz der Beigeladenen vom 25. Juni 2021 nebst Anlagen.
Hinsichtlich dieser Feststellungen der Vergabekammer ist klarzustellen, dass der Antragstellerin durch das Schreiben vom 26.03.2021 nicht nur mitgeteilt wurde, dass sie auszuschließen sei, sondern dass der Ausschluss erfolgt und nunmehr beabsichtigt sei, den Zuschlag am 06.04.2021 auf das Angebot der Beigeladenen zu erteilen.
In den nach dem Verhandlungstermin im HMdIS aktualisierten Vergabeunterlagen heißt es in Nr. 6 der (ergänzenden) Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen (Bl. 513 Vergabeakte II, Unterstreichungen durch den Senat):
6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrags im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, die gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen vorzulegen.
(…)
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.
Der “fachanwaltliche Vergabevermerk”, Bl. 1124 der Vergabeakte II, ist in dieser Form nicht von der Vergabestelle umgesetzt worden. Der Vergabeakte lässt sich nicht entnehmen, dass die Vergabestelle sich entschlossen hätte, den “fachanwaltlichen Vergabevermerk” so in ihren Willen aufzunehmen; vielmehr hat sie einen eigenen Vermerk erstellt (Bl. 1208 ff Vergabeakte II).
Die Vergabekammer hat den Antragsgegner verpflichtet, die Wertung der Angebote einschließlich des Angebotes der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer erneut durchzuführen.
Zur Begründung, für deren Einzelheiten auf die angefochtene Entscheidung Bezug genommen wird, hat sie ausgeführt, der Nachprüfungsantrag sei zulässig und begründet. Der Ausschluss der Antragstellerin wegen fehlender Unterlagen sei rechtswidrig, weil die Antragstellerin keine Unterauftragnehmer im Sinne des § 36 VgV einsetze und somit dem finalen Angebot das Formular 235, die Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentgelt und die Erklärung betreffend den Ausschluss wegen schwerer Verfehlungen für Unterauftragnehmer nicht habe beifügen müssen. Weder habe die Antragstellerin erklärt, Unterauftragnehmer einsetzen zu wollen, noch handele es sich bei dem Neubau der Brandsimulationsanlage einschließlich des Orientierungsraums durch die B GmbH (nachfolgend B genannt) und dem Transport dieser Anlagen ggfls. durch einen Spediteur zu verschiedenen Veranstaltungsorten um Nachunternehmerleistungen im Sinne des § 26 VgV.
Mit seiner sofortigen Beschwerde verfolgt der Antragsgegner seinen Zurückweisungsantrag weiter. Er wiederholt und vertieft sein Vorbringen vor der Vergabekammer und macht außerdem geltend, die Antragstellerin sei auch deshalb als ungeeignet auszuschließen, weil sie keine ausreichenden Referenzen vorgelegt habe. Da die Antragstellerin – was hinsichtlich des Unternehmensträgers unbestritten ist – erst am 07.02.2017 gegründet worden sei, sei ihr die erste der sechs angegeben Referenzen wegen des Ausführungszeitraums “2009” nicht zuzuordnen. Sie falle auch aus der Dreijahresfrist, gerechnet vom Schluss der Angebotsfrist, heraus. Die übrigen Referenzen seien nicht geeignet, die Eignung nachzuweisen. Sie seien zwar zu prüfen, sie erreichten aber den gegenständlichen Auftragswert nicht einmal annähernd. Sie seien daher mit dem Auftragsgegenstand nicht vergleichbar.
Der Antragsgegner beantragt nunmehr
den Beschluss der 2. Vergabekammer des Landes Hessen vom 01.07.2021, Az. 69d-VK2-16/2021 aufzuheben und den Nachprüfungsantrag der Antragstellerin vom 01.04.2021 zurückzuweisen;
hilfsweise, die Vergabekammer zu verpflichten, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts über die Sache erneut zu entscheiden;
die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie des Nachprüfungsverfahrens (69d-VK2-16/2021) einschließlich der jeweiligen notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners der Antragstellerin aufzuerlegen;
die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch den Antragsgegner für notwendig zu erklären.
Die Antragstellerin beantragt,
die sofortige Beschwerde zurückzuweisen;
die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin dem Antragsgegner aufzuerlegen;
die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Antragstellerin für notwendig zu erklären.
Die Beigeladene stellt keinen Antrag.
Die Antragstellerin und die Beigeladene wiederholen und vertiefen ihr Vorbringen vor der Vergabekammer.
II.
1. Die sofortige Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere statthaft und in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet worden, § 172 GWB.
2. In der Sache hat die sofortige Beschwerde keinen Erfolg. Die Beschwerde ist mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Vergabestelle nunmehr an die Rechtsauffassung des Senats gebunden wird und sie das Angebot der Antragstellerin – auch hinsichtlich der Eignungsanforderungen an etwaige Subunternehmer – neu zu prüfen hat.
a) Der Nachprüfungsantrag ist zulässig. Insoweit wird auf die unangefochtenen Ausführungen der Vergabekammer Bezug genommen.
b) Der Nachprüfungsantrag ist auch begründet. Die Vergabestelle hat den Anspruch der Antragstellerin auf ein bestimmungsgemäß durchgeführtes Vergabeverfahren aus § 97 VI GWB verletzt.
aa) Die Vergabestelle hat das Angebot der Antragstellerin gem. § 57 I Nr. 2 VgV mangels Erfüllung der Eignungsanforderungen aufgrund fehlender Unterlagen ausgeschlossen (Bl. 1136, 1134 Vergabeakte II). Diese Begründung des Ausschlusses hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Insoweit kann dahinstehen, ob B nach dem Angebot der Antragstellerin überhaupt – wie von dem Antragsgegner angenommen – Subunternehmer hinsichtlich der ausgeschriebenen Leistungen sein sollte.
(1) Allerdings darf die Vergabestelle die Eignung eines Bewerbers jedenfalls dann neu beurteilen, wenn die Zweifel an der Eignung nachträglich, also nach einer vorherigen Prüfung und Bejahung der Eignung, aufgrund eines geänderten Sachverhaltes entstanden sind (vgl. Opitz in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, 3. Auflage, § 122 GWB, Rn. 25). Die Prüfung, ob die erstmalige Erklärung der Antragstellerin im Begleitschreiben vom 13.01.2021, alle Arbeiten würden durch B erbracht, Einfluss auf die Erfüllung der Eignungskriterien hatte, war daher zulässig.
(2) Nach der unter I. wiedergegebenen, an § 36 V VgV anknüpfenden Regelung unter Nr. 6. der (ergänzenden) Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen (Bl. 513 Vergabeakte II) hätte die Vergabestelle bei Verneinung der Eignung von B als Subunternehmerin oder bei Annahme eines diese betreffenden Ausschlussgrundes nicht die Eignung der Antragstellerin verneinen dürfen, sondern diese zur Ersetzung des Subunternehmers binnen zu bestimmender Frist auffordern müssen. Dabei kann es keinen Unterschied machen, ob die Eignung wegen des Inhalts vorgelegter Unterlagen oder wegen fehlender Unterlagen nicht als gegeben angenommen werden kann.
bb) Der Ausschluss des Angebots der Antragstellerin rechtfertigt sich auch nicht aus § 57 I Nr. 2, § 53 VII VgV. Auch insoweit kann dahinstehen, ob die Annahme der Vergabestelle, die Antragstellerin wolle alle ausgeschriebenen Leistungen durch B als Subunternehmerin ausführen lassen, zutrifft.
(1) Nach § 53 VII 2 VgV müssen die Angebote vollständig sein, und alle geforderten Angaben und Erklärungen enthalten. Dazu gehört bei Einsatz von Subunternehmern nach Abschnitt B der Angebotsaufforderung Bl. 526 Vergabeakte II und gem. Nr. 2.3.31 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung das Formular 235 (Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen), das bei Annahme einer Subunternehmerstellung der B fehlen würde.
Demgegenüber war die Verpflichtungserklärung Tariftreue/Mindestentgelt sowohl nach Nr. 2.3.32 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung, als auch nach Nr. 6 der ergänzenden Bewerbungsbedingungen noch nicht mit dem Angebot, sondern erst auf Aufforderung vorzulegen. Soweit die ursprüngliche Auftragsbekanntmachung vom Dezember 2019 (Bl. 1158 f. Vergabeakte I) die Vorlage der Verpflichtungserklärung für schon bekannte Nachunternehmer bereits mit dem Angebot vorsah (S. 3, Bl. 114 Vergabeakte I unter III.2.2), ist dies durch die überarbeiteten Vergabebedingungen des neuen Vergabeverfahrens überholt.
Hinsichtlich der Erklärung betreffend den Ausschluss der Subunternehmer wegen schwerer Verfehlungen fehlt zwar eine entsprechende ausdrückliche Regelung unter 2.3.32, insoweit ergibt sich jedoch aus Nr. 6 der ergänzenden Bewerbungsbedingungen, dass die Eignung der Subunternehmer erst auf Aufforderung nachzuweisen ist, d.h. die Erklärung als Subunternehmer-Eignungsnachweis ebenfalls noch nicht mit dem Angebot vorzulegen war.
(2) Auf Grundlage des von der Vergabestelle angenommenen Angebotsinhalts hatte diese daher unter dem Gesichtspunkt des § 57 VgV eine Ermessensentscheidung gem. § 56 II VgV über ein Nachfordern der fehlenden Unterlage 235 zu treffen. Bezüglich der beiden anderen vorgenannten Unterlagen greift § 56 II VgV nicht ein. Das erstmalige Anfordern von Unterlagen, deren spätere Anforderung sich der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zunächst vorbehalten hat, ist kein “Nachfordern” im Sinne der Norm (MüKoEuWettbR/Pauka, 2. Aufl. 2018, § 56 VgV, Rn. 30).
Soweit es unter 3.2 der Ergänzung zur Angebotsaufforderung heißt, eine Aufforderung betreffend Nachforderung, Vervollständigung, Berichtigung von Unterlagen bzw. eine Aufklärung erfolge, wenn dies “vergaberechtlich zulässig und geboten” sei (Bl. 518 der Vergabeakte II), folgt daraus weder eine von § 57 VgV abweichende Rechtsfolge, noch eine Änderung hinsichtlich der im Rahmen des Ermessens zu berücksichtigenden Umstände. Vielmehr ist – etwas anderes macht auch der Antragsgegner nicht geltend – das Merkmal der Zulässigkeit der Nachforderung auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 56 II VgV und das Merkmal der Gebotenheit auf das Ergebnis der Ermessensausübung nach § 56 II VgV zu beziehen.
(3) Die Ermessensentscheidung der Vergabestelle hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
(a) Die Vergabestelle hat den Ausschluss der Antragstellerin damit begründet, dass die erforderliche Eignung der Antragstellerin – die während des gesamten Verfahrens zu prüfen sei – nicht festgestellt werden könne, weil sie für alle Arbeiten die Fa. B GmbH als Subunternehmerin einsetzen wolle und hinsichtlich dieser die notwendigen Unterlagen nicht vorgelegt habe. Eine Nachforderung dieser Unterlagen sei weder geboten noch erforderlich. Dabei findet sich die Wendung zur Ausführung aller Arbeiten durch B nicht in den Angebotsunterlagen selbst, sondern in einem Begleitschreiben vom 13.01.2021, Bl. 777 der Vergabeakte II, und lautet wörtlich (Unterstreichung durch den Senat):
“(…) Aufgrund der neuen Version der Unterlagen wurde unsere Kalkulation entsprechend angepasst. Die Erhöhung des Stundenpreises kommt insbesondere zustande durch:
– Ausführung aller Arbeiten durch die Firma B GmbH
– Neubewertung der Inflationsgefahren für die kommenden Jahre
– Konkretisierung der geplanten Ausführung des Orientierungsraumes durch den Auftraggeber
(…)”
In dem Ausschlussschreiben heißt es zur Ermessensausübung (Bl. 1133 der Vergabeakte II, Hervorhebung im Original):
“Eine Nachforderung der fehlenden Unterlagen gem. § 56 Abs. 2 VgV ist vorliegend weder geboten noch erforderlich. Ergibt die Prüfung auf Vollständigkeit wie vorliegend, dass Unterlagen fehlen, unvollständig oder (bei unternehmensbezogenen Unterlagen) fehlerhaft sind, können diese nach den Regelungen des § 56 Abs. 2 und Abs. 3 VgV bis zum Ablauf einer vom Auftraggeber zu bestimmenden Nachfrist grundsätzlich nachgefordert werden. Es besteht insoweit jedoch keine Verpflichtung des Auftraggebers zur Nachforderung.
Nach Ausübung des Ermessens und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach § 97 Abs. 1 S. 2 GWB ist vorliegend keine Nachforderung geboten. Insoweit würde eine Nachforderung zu einer weiteren, unzumutbaren Verzögerung des Vergabeverfahrens führen. Weiterhin wurde auf Bitten Ihres Unternehmens die Angebots- und Ausschlussfrist zur Abgabe der finalen Angebote bereits um 10 Kalendertage verlängert. Insoweit würde eine entsprechende Nachforderung nicht nur zu einer Besserstellung Ihres Unternehmens und damit zu einer unzulässigen Diskriminierung anderer Verfahrensteilnehmer führen. Dies ist jedoch mit den vergaberechtlichen Grundsätzen der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung i.S.v. § 97 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 GWB nicht zu vereinbaren.”
Im Nichtabhilfeschreiben vom 01.04.2021, Bl. 1194 ff. Vergabeakte II, wird die Ermessensentscheidung verteidigt. Im Zuge allgemeiner Rechtsauführungen zum Ermessen, zur Auslegung des § 56 II VgV und den Grenzen gerichtlicher Kontrolle heißt es, das Gleichbehandlungsgebot zwinge dazu, von einer Nachforderungsmöglichkeit nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Regelung sei nicht als Soll-Vorschrift zu lesen. Im Übrigen wird für den vorliegenden Fall ausgeführt, es habe keine Ermessensreduzierung auf Null vorgelegen. Es werden Ermessenserwägungen aus dem Ausschlussschreiben wiederholt. Ergänzend wird ausgeführt, sofern die Antragstellerin trotz der verlängerten Angebots- und Ausschlussfrist “nicht Willens oder faktisch nicht in der Lage” sei, die “geforderten Unterlagen bis zum Fristablauf entsprechend den transparent und diskriminierungsfrei aufgestellten Anforderungen beizubringen”, sei es “nicht an der Vergabestelle, diese Versäumnisse zu Lasten der anderen Wettbewerbsteilnehmer zu heilen”. Vielmehr würde eine entsprechende “Bevorzugung” der Antragstellerin “gegen die Grundpfeiler des (Kartell-)Vergaberechts in Form der Gleichbehandlung, der Transparenz und der Nichtdiskriminierung verstoßen” (S. 10, Bl. 1185 Vergabeakte II).
(b) Die Ermessensentscheidung ist von den Nachprüfungsinstanzen nur beschränkt und zwar analog § 114 VwGO daraufhin zu überprüfen, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist. Neben einem Ermessensnichtgebrauch (Ermessensausfall) und einer Ermessensüberschreitung kommt dabei – hier allein relevant – ein Ermessensfehlgebrauch in Betracht.
Hierher gehören zum einen die Fälle, in denen die Behörde nicht alle wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt oder nicht alle für die Entscheidung bedeutsamen Tatsachen ermittelt hat. Zum anderen handelt es sich um die Fälle, in denen die Behörde den Zweck der Ermächtigung verkannt hat. Schließlich geht es um die Fälle, in denen die Behörde bewusst aus unsachlichen Motiven gehandelt hat. Ein Ermessensfehlgebrauch führt auch dann zur Rechtswidrigkeit der Ermessensentscheidung, wenn die gewählte Rechtsfolge im Ergebnis auch auf der Grundlage vollständiger und fehlerfreier Ermessenserwägungen hätte angeordnet werden können. Denn beim Ermessensfehlgebrauch geht es um einen Verstoß gegen die “inneren” Grenzen des Ermessens, während die Ermessensüberschreitung die “äußeren” Grenzen des Ermessens betrifft und voraussetzt, dass die angeordnete Rechtsfolge nicht von der Ermessensermächtigung gedeckt ist, im Ergebnis also unabhängig von den zugrunde liegenden Ermessenserwägungen nicht angeordnet werden durfte (BeckOK VwVfG/Aschke, 52. Ed. 1.7.2021, § 40 VwVfG, Rn. 85 f., 87).
(c) Gemessen an diesen Grundsätzen kann die Ermessensentscheidung der Vergabestelle keinen Bestand haben.
Zum einen ist die Ermessensausübung schon deshalb defizitär, weil sie die Nachforderung der Unterlagen unter dem Gesichtspunkt des Ausschlusses des Angebots wegen fehlenden Eignungsnachweises der Subunternehmer und nicht (nur) der Nichteinhaltung der Anforderungen des § 53 VII VgV prüft. Das Formular 235 ist selbst kein Eignungsnachweis, sondern gibt nur Auskunft darüber, ob die Eignungs- und Ausschlussprüfung auf Subunternehmer erstreckt werden kann oder gar muss.
Die Ermessensentscheidung berücksichtigt auch nicht, dass eine zeitliche Verzögerung bei jeder Nachforderung gegeben ist, Nachforderungen aber gleichwohl grundsätzlich zulässig sind und der pauschale Hinweis auf Verzögerungen allein daher keine tragfähige Erwägung darstellen kann. Grundsätzlich bedarf es vielmehr der Abschätzung der konkret zu erwartenden Verzögerung und deren Auswirkungen auf das Verfahren und ist auch zu berücksichtigen, ob die Vergabestelle diese Auswirkungen durch frühere Nachforderung hätte abmildern oder vermeiden können. Dabei wäre vorliegend eine Nachreichung des Formulars 235 auch ohne besondere Eile binnen weniger Tage, bei Eilbedürftigkeit notfalls auch binnen weniger Stunden möglich gewesen. Ebenso ist unberücksichtigt geblieben, dass die im Formular vermisste Information auf Grundlage der Auslegung der Vergabestelle – Erbringung aller Leistungen durch B – schon vorlag, so dass die Vergabestelle noch innerhalb der Angebotsfrist informiert, der Fehler also rein formal war. Die Vergabestelle hat ferner nicht berücksichtigt, dass es – wie oben ausgeführt – auch bei Vorlage eines in ihrem Sinne ausgefüllten Formulars weiterer Nachfragen bedurft hätte, das Verfahren im Vergleich zu einem Angebot ohne den angenommenen Fehler also nicht verzögert wurde, da die weiteren Nachweise mit dem Formular gemeinsam hätten angefordert werden können.
Rechtsfehlerhaft ist die Erwägung der Vergabestelle, gegen die Nachforderung sprächen frühere “Verzögerungen” sowie die Verlängerung der Angebots- und Ausschlussfrist zur Abgabe der finalen Angebote um 10 Kalendertage. Es ist nicht ersichtlich, dass aufgrund der Verlängerungen eine die Nachforderung infrage stellende Eilbedürftigkeit eingetreten wäre. Soweit das Vergabeverfahren insgesamt länger gedauert hat, als bei Beginn erwartet, beruht dies auf Entscheidungen der Vergabestelle bzw. darauf, dass diese Rügen der Antragstellerin abgeholfen hat. Hilft die Vergabestelle aber einer Rüge ab, ohne dass dies von anderen Bietern erfolgreich angefochten wird, ist für das weitere Verfahren von einer berechtigten Rüge auszugehen, deren Erheben kein Kriterium bei einer zu Lasten der Antragstellerin gehenden Ermessensentscheidung sein kann.
Ferner hat die Vergabestelle bei ihrer Ermessensentscheidung nicht berücksichtigt, dass bei Ausschluss der Antragstellerin nur noch die Beigeladene als einzige Bewerberin übrigbleiben wird und damit der Zweck des Vergabeverfahrens, die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers zu den bestmöglichen Konditionen zu befriedigen (EuG, Urteil vom 13. September 2011 – T-8/09 -, juris), allenfalls unzulänglich erreicht werden kann. Unberücksichtigt ist auch geblieben, dass § 56 II VgV auf eine möglichst weitgehende Berücksichtigung von Bieterangeboten zielt (Dieckmann in Dieckmann/Scharf/Wagner-Cardenal, VgV, UVgO, 2. Auflage, § 15 VgV, Rn. 20; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.10.2015 – Verg 35/15 “Traggerüst”, Rn. 35 zur VOB/A-EG). Die Vorschrift bezweckt, im Interesse eines umfassenden Wettbewerbs den Ausschluss von Angeboten aus vielfach nur formalen Gründen zu verhindern und die Anzahl der am Wettbewerb teilnehmenden Angebote nicht unnötig zu reduzieren (BGH, Urteil vom 19. Juni 2018 – X ZR 100/16 “Uferstützmauer”, juris, Rn. 11 = BGHZ 219, 108).
Soweit § 56 II VgV auf die Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung abstellt, ist dies nicht dahin zu verstehen, andere Gesichtspunkte und insbesondere der Zweck des Vergabeverfahrens seien unerheblich. Vielmehr sind die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung bei der unter Einbeziehung anderer Gesichtspunkte zu treffenden Entscheidung zu beachten.
cc) Das Angebot der Antragstellerin war auch nicht deshalb wegen unklarer Angaben gem. § 57 I VgV auszuschließen, weil die Antragstellerin entgegen § 53 VII VgV mehrdeutige Angaben gemacht hat.
(1) Zwar führt 57 VgV unter Nr. 3 nur wegen Änderungen und Ergänzungen an den Bietereintragungen in den Vergabeunterlagen nicht zweifelsfreie Angebote als insbesondere auszuschließende Angebote auf. Ausschlussgrund ist bei Nr. 3 jedoch die Unsicherheit über den Angebotsinhalt, die auch auf den unveränderten – für sich genommen klaren – Vergabeunterlagen beigefügten weiteren Erklärungen – hier dem Begleitschreiben vom 13.01.2021 – beruhen kann.
(2) Das Angebot der Antragstellerin ist unter Einbeziehung des Begleitschreibens vom 13.01.2021 widersprüchlich und unklar. Es lässt sich weder eindeutig dahin auslegen, dass die Antragstellerin sämtliche ausgeschriebenen Leistungen durch die B als Subunternehmerin erbringen will, noch dass B nur als Lieferantin und für Hilfsdienste einbezogen würde (wie die Vergabekammer angenommen hat).
Zwar deutet der Wortlaut “Ausführung aller Arbeiten durch die Firma B GmbH” für sich genommen auf eine Einschaltung der B als Subunternehmerin hinsichtlich des gesamten Auftragsgegenstandes hin, dessen genaue Abgrenzung insoweit dahinstehen kann. Dagegen spricht jedoch das Nichtausfüllen des Formblatts 235 sowie der Umstand, dass eine solch weitgehende Befassung der B in den erst am 02.02.2021 (vgl. Bl. 810 Vergabeakte II) abschließend erstellten Angebotsunterlagen nicht berücksichtigt worden ist. Auch kann die Wendung im weiteren Begleitschreiben vom 10.01.2021, der Hersteller werde das Bedienpersonal schulen, dahin gedeutet werden, es handele sich nicht um Personal des Herstellers B selbst, sondern um solches der Antragstellerin. Gegen ein Verständnis der Wendung im Begleitschreiben vom 13.01.2021 im Sinne einer umfassenden Subunternehmerstellung von B spricht auch, dass sie nicht im Zusammenhang mit den Leistungsumfang betreffenden Fragen steht, sondern nur die Preisdifferenz zum vorangegangenen indikativen Angebot erläutern soll. Dies drängt aber entgegen der Auffassung der Vergabekammer gleichwohl nicht hinreichend eindeutig zu einer Auslegung dahingehend, B solle nur die Herstellung der Brandsimulationsanlage als Lieferantin erbringen (VKB20). Denn die Antragstellerin hatte im Verhandlungsgespräch im HMdIS bereits ausgeführt, der Brandübungscontainer solle von B gebaut werden (Bl. 292 Vergabeakte II). Sie gehe davon aus, dass sie für den Neubau bessere Konditionen bekomme als andere Kunden, da sie wahrscheinlich mittelfristig mit B zusammenarbeiten werde (Bl. 291 Vergabeakte II). Es sei ohnehin ein Neubau geplant, alles sei überschaubar und sie habe wegen ihrer schlanken Unternehmensstruktur praktisch keine fixen Kosten. Der Preis scheine gering zu sein, sei aber auskömmlich. Vor diesem Hintergrund kann die Erläuterung der Preiserhöhung dahingehend, alle Arbeiten würden durch B ausgeführt, auch so verstanden werden, B mache nun mehr, als noch im Verhandlungsgespräch zu Grunde gelegt.
Danach lässt sich dem Angebot der Antragstellerin unter Berücksichtigung des Begleitschreibens nur sicher entnehmen, dass B Hersteller der Simulationsanlage sein soll, nicht aber, ob und in welchem Umfang B weitere Tätigkeiten verrichten wird; insoweit ist das Angebot widersprüchlich.
(3) Diese Widersprüchlichkeit rechtfertigt jedoch den Ausschluss des Angebots der Antragstellerin nicht.
Da das Angebot nicht eindeutig war, kam eine Aufklärung nach §§ 16 IX, 15 V 1 VgV in Betracht (vgl. Dieckmann aaO, § 15 VgV, Rn. 23). Es kann dahinstehen, ob die Vergabestelle bei widersprüchlichen Angeboten vor einem Ausschluss zum Versuch einer Aufklärung verpflichtet ist (so OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017 – Verg 33/1 “Personalkonzept”, Rn. 94; Beschluss vom 21.10.2015 – Verg 35/15 “Traggerüst” Rn. 35 f.; allgemein Diekmann aaO, § 15 VgV, Rn. 24) oder nur eine Ermessensentscheidung darüber zu treffen hat, ob und inwieweit sie Aufklärung betreiben will (so wohl Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urteil vom 06. September 2011 – 6 U 2/11, juris, Rn. 49, Pünder/Klafki in Pünder/Schellenberg, VergabeR, 3. Auflage, § 15 VgV, Rn. 32). Denn die Vergabestelle, die rechtsfehlerhaft angenommen hat, das Angebot sei eindeutig, hat insoweit kein Ermessen ausgeübt; es läge ggfls. ein Ermessensausfall vor.
(4) Hätte die Antragstellerin im Zuge einer Aufklärung klargestellt, dass B nur mit der Herstellung der Brandsimulationsanlage beauftragt werden solle, wie sie im Nachprüfungsverfahren geltend macht, wäre von keiner Nachunternehmerstellung der B auszugehen und das Formular 235 nicht auszufüllen gewesen. Das Angebot hätte dann nicht unter diesem Gesichtspunkt ausgeschlossen werden dürfen.
Nachunternehmer ist eine natürliche oder juristische Person, die im Auftrag und auf Rechnung des Auftragnehmers eine Teilleistung des öffentlichen Auftrags erbringt und dabei in keiner vertraglichen Verbindung zu dem öffentlichen Auftraggeber steht. Der Nachunternehmer schuldet gegenüber dem (Haupt-) Auftragnehmer einen vertraglichen Erfolg und deckt damit einen Teil der vom (Haupt-) Auftragnehmer gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber übernommenen Primärleistung selbständig ab (Scharf in Dieckmann/Scharf/Wagner-Cardenal/Scharf, 2. Aufl. 2019, VgV § 36 Rn. 7). Die Unterauftragsleistung ersetzt als Teilleistung die Erfüllung einer Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers nach Außen (Peshteryanu in BeckOK VergabeR, 21. Ed. 31.1.2021, § 36 VgV, Rn. 3). Damit unterscheidet sich der Nachunternehmer von Lieferanten, Verleihern von Personal und Geräten, Transportunternehmern und Erbringern von sonstigen Hilfsleistungen, die selbst keinen Teil der Primärleistung übernehmen (Scharf aaO).
Gegenstand des ausgeschriebenen öffentlichen Auftrags ist, wie die Vergabekammer zu Recht angenommen hat, die Vermietung und Zurverfügungstellung der Brandsimulationsanlage an wechselnden Standorten sowie die Mitwirkung an der Ausbildung. Der Aufragnehmer schuldet dem Aufraggeber nicht unmittelbar den Bau der Anlage oder Instandhaltungsarbeiten an dieser, weshalb der Hersteller nicht Subunternehmer des Auftragnehmers ist, auch nicht, soweit er Wartungen und Reparaturen ausführt. Dies gilt auch, soweit der Hersteller oder ein sonstiger Dritter die Mitarbeiter der Antragstellerin (!) schult.
Ob im vorliegenden Einzelfall die Übernahme des Transports oder anderer zur Auftragserfüllung notwendiger Leistungen eine Subunternehmerstellung begründen würde, bedarf keiner Entscheidung.
dd) Das Angebot der Antragstellerin ist entgegen der Auffassung der Beschwerde auch nicht deshalb mangels Eignung der Antragstellerin gem. § 122 I GWB auszuschließen, weil die Antragstellerin keine vergleichbaren Referenzobjekte benannt hatte.
Zwar nimmt die überarbeitete Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Bl. 526 ff. Vergabeakte II, unter 3.1 auf die ursprüngliche Auftragsbekanntmachung vom 02.12.2019, Bl. 104 ff. Vergabeakte I, Bezug und verlangt diese unter III.3 zur technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
“eine Liste mit geeigneten Referenzen der in den letzten drei Jahren im wesentlichen erbrachten Leistungen mit folgenden Angaben: Art und Umfang, Erbringungszeitpunkt, Angabe des Wertes, öffentlicher oder privater Empfänger mit jeweiligen Kontaktdaten (Referenzen sind dann geeignet, wenn diese in Art und Umfang dem hier zu vergebenden Auftrag entsprechen.)”.
Entsprechende Angaben finden sich auch in der damaligen Angebotsaufforderung Bl. 64 ff. Vergabeakte I bei der Auflistung der Angebotsbestandteile unter 2.3.5.
Damit sind zwar keine Eignungskriterien – die systematisch von den Eignungsnachweisen zu unterscheiden sind – ausdrücklich formuliert. Sie können aber aus dem geforderten Nachweis insofern abgeleitet werden (vgl. Opitz in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, 3. Auflage, § 122 GWB, Rn. 52), als dass die Bewerber durch frühere vergleichbare Projekte über hinreichende Erfahrungen verfügen sollen.
Trotz der Bezugnahme auf die Angebotsaufforderung durfte ein verständiger Bieter jedoch davon ausgehen, dass dieses Erfordernis nach Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen durch die Vergabestelle nicht mehr aufrechterhalten worden ist. Denn die hier maßgebliche überarbeitete Angebotsaufforderung Bl. 526 ff. Vergabeakte II enthält in der Liste der Angebotsbestandteile keine Referenzliste mehr. Die hiesige Nr. 2.3.5 betrifft die Erklärung Unternehmensdaten (Nr. 2.3.6 der ursprünglichen Angebotsaufforderung Bl. 64 ff. Vergabeakte I). Die Passage zur Referenzliste aus der früheren Angebotsaufforderung Bl. 64 ff. Vergabeakte I ist ersatzlos weggefallen. Dies ist nicht so zu verstehen, dass damit nur dem Umstand Rechnung getragen würde, dass eine Referenzliste bereits vorgelegt worden war. Denn bei anderen Unterlagen, die nur wegen der schon erfolgten früheren Einreichung nicht mehr verlangt werden, ist dies jeweils vermerkt worden; sie wurden nicht ersatzlos aus dem Text gestrichen.
Deshalb kann dahinstehen, ob überhaupt neue Erkenntnisse vorliegen, die bei einem Verhandlungsverfahren eine nachträgliche Verneinung der Eignung ermöglichen (vgl. BGH, Beschluss vom 07. Januar 2014 – X ZB 15/13 “Stadtbahnprogramm Gera”, juris, Rn. 33 = BGHZ 199, 327; Opitz in Burgi/Dreher, Beck’scher Vergaberechtskommentar, 3. Auflage, § 122 GWB, Rn. 25). Die erste Referenz lag von Anfang an und unabhängig vom Gründungszeitpunkt der Antragstellerin außerhalb des Referenzzeitraums und die Auftragswerte der übrigen Referenzen waren ebenfalls von Anfang an bekannt. Neu ist lediglich, dass die übrigen Referenzprojekte bereits vor Gründung der Antragstellerin begonnen, aber nach ihrer Gründung abgeschlossen wurden.
c) Hinsichtlich der Kosten vor der Vergabekammer verbleibt es bei der dortigen Kostengrundentscheidung, die der Antragsgegner für den Fall eines Unterliegens in der Hauptsache ebenso wenig angreift, wie die dortige Kostenfestsetzung. Dies gilt auch, soweit die Hinzuziehung der Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin gem. § 1824 S. 4 GWB i.V.m. § 80 Abs. 3 S. 2 VwVfG für notwendig erklärt worden ist.
3. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf §§ 175 II, 71 GWB. Da die sofortige Beschwerde im Wesentlichen erfolglos geblieben ist, entspricht es billigem Ermessen, die Kosten dem beschwerdeführenden Antragsgegner vollumfänglich aufzuerlegen. Hinsichtlich der – nicht § 71 S. 2 GWB unterfallenden – Kosten des Beigeladenen, der an den sonstigen Verfahrenskosten nicht zu beteiligen ist (Bechtold/Bosch in dies., GWB, 10. Aufl. 2021, § 71 Rn. 9), entspricht es billigem Ermessen, dass diese vom Beigeladenen, der die angefochtene Entscheidung im Wesentlichen erfolglos verteidigt hat, selbst getragen werden.
Unter “Kosten” des Verfahrens im Sinne des § 71 GWB sind dabei sowohl die Gerichtskosten als auch die außergerichtlichen Kosten der Parteien zu verstehen (Bechtold/Bosch aaO, § 71 Rn. 2), einer Entscheidung über die Notwendigkeit der Hinzuziehung der Prozessbevollmächtigten bedarf es insoweit nicht.
4. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 50 II GKG.