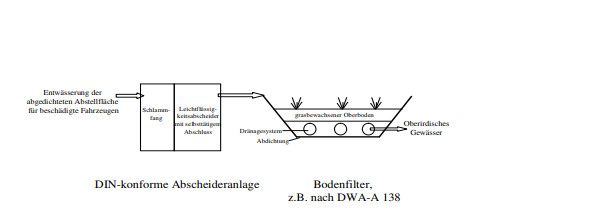Macht ein Auftragnehmer Ansprüche wegen Bauzeitverlängerung geltend, die sowohl auf vertragsgemäßen Anordnungen als auch auf vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers beruhen, müssen die vertragsgemäßen und vertragswidrigen Bauzeitverlängerungen hinsichtlich ihrer jeweiligen Ursache und ihres jeweiligen Umfangs deutlich getrennt voneinander dargelegt werden. Nur dann sind die Voraussetzungen für die verschiedenen Ansprüche schlüssig dargelegt. Macht der Auftragnehmer Schadensersatz wegen Bauablaufstörungen geltend, hat er im Einzelnen darzulegen, welche konkreten Mehrkosten ihm konkret durch welche Behinderung tatsächlich entstanden sind. Hiermit lässt sich eine Schadensberechnung, die einen von dem jeweiligen Fall losgelösten, nur an allgemeinen Erfahrungssätzen orientierten Schaden ermittelt, nicht vereinbaren. Eine abstrakte Zuordnung und Schadensberechnung, bei der dem vom Auftragnehmer zugrunde gelegten Bauablauf (Soll 1) der sog. störungsmodifizierte Bauablauf (Soll 2) ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs gegenübergestellt wird, ist für den Schadensnachweis nur bedingt geeignet.
Bauzeitverlängerungen, die teils auf vertragsgemäßen Anordnungen bzw. sonstigen Baubehinderungen beruhen
Behauptet der Auftragnehmer verschiedene Bauzeitverlängerungen, die teils auf vertragsgemäßen Anordnungen bzw. sonstigen Baubehinderungen beruhen, muss er hinsichtlich der einzelnen Verlängerungen und ihrer jeweiligen Baubehinderungen beruhen, muss er hinsichtlich der einzelnen Verlängerungen und ihrer jeweiligen Ursachen differenziert vortragen. Diese Differenzierung hat der Auftragnehmer zu beachten, wenn er im Prozess die tatsächlichen Voraussetzungen für einen Vergütungsanspruch gem. § 2 Nr. 5 VOB/B, für einen Schadensersatzanspruch gem. § 6 Nr. 6 VOB/B ein konkreter zurechenbarer Schaden und bei dem Entschädigungsanspruch gem. § 642 BGB die Grundlagen für die Festsetzung einer angemessenen Entschädigung durch den Auftragnehmer vorgetragen werden.
Ansprüche wegen Verlängerung der Bauzeit die sowohl auf vertragsgemäßen Anordnungen als auch auf vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers beruhen
Macht ein Auftragnehmer Ansprüche wegen Verlängerung der Bauzeit geltend, die sowohl auf vertragsgemäßen Anordnungen als auch auf vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers beruhen, ist es im Hinblick auf die unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen mit den verschiedenen Anspruchsvoraussetzungen erforderlich, dass die vertragsgemäßen und vertragswidrigen Bauzeitverlängerungen hinsichtlich ihres jeweiligen Umfangs deutlich getrennt voneinander dargelegt werden. Nur dann sind die Voraussetzungen für die verschiedenen Ansprüche schlüssig dargelegt und die behaupteten Tatsachen gegebenenfalls einer Beweisaufnahme zugänglich (OLG Hamm NZBau 2006, 180, beck-online).
Erforderlich ist eine plausible Darlegung, ob bzw. in welchem Umfang die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung durch eine andere Anordnung des Auftraggebers i.S. des § 2 Nr. 5 VOB/B geändert wurden.
Differenzierung zwischen den behaupteten Baubehinderungen im Einzelnen und den Bauzeitverlängerungen auf Grund vertragsgemäßen und vertragswidrigen Verhaltens
Erforderlich ist eine Differenzierung zwischen den behaupteten Baubehinderungen im Einzelnen und den Bauzeitverlängerungen auf Grund vertragsgemäßen und vertragswidrigen Verhaltens. Nur dann sind hindernde Umstände im Sinne des § 6 Nr. 6 VOB/B nicht hinreichend deutlich dargelegt. Darüber hinaus sind bezüglich der einzelnen Behinderungen die nachweisbar entstandenen Schäden im Sinne der Vorschrift darzulegen.
Vergleichsweise Darstellung des tatsächlichen gegenüber dem hypothetischen Bauablauf
Nach der Differenzhypothese ist eine vergleichsweise Darstellung des tatsächlichen gegenüber dem hypothetischen Bauablauf vorzunehmen. Der Geschädigte hat im Einzelnen darzulegen, welche Mehrkosten ihm konkret durch die Behinderung tatsächlich entstanden sind, da nach § 6 Abs. 6 VOB/B nur der nachweislich entstandene Schaden zu ersetzen ist. Hiermit lässt sich eine Schadensberechnung, die einen von dem jeweiligen Fall losgelösten, nur an allgemeinen Erfahrungssätzen orientierten, unter Umständen gar nicht eingetretenen Schaden ermittelt, nicht vereinbaren, da nur der dem Geschädigten wirklich entstandene Schaden zu ersetzen ist (BGH NJW 1986, 1684 BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6 Rn. 29, 30).
Abstrakte Zuordnung und Schadensberechnung bei der dem vom Auftragnehmer bei der Kalkulation zugrunde gelegten Bauablauf (Soll 1) der sog. „störungsmodifizierten“ Bauablauf (Soll 2) ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs gegenübergestellt wird
Eine abstrakte Zuordnung und Schadensberechnung bei der dem vom Auftragnehmer bei der Kalkulation zugrunde gelegten Bauablauf (Soll 1) der sog. „störungsmodifizierten“ Bauablauf (Soll 2) ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs gegenübergestellt wird, ist somit für den Schadensnachweis nur bedingt geeignet, da damit nur eine verallgemeinernde, vom Einzelfall losgelöste, letztlich weitgehend fiktive Berechnungsmethode herangezogen wird (BGH NJW 1986, 1684; BGH NZBau 2002, 381; BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6 Rn. 29, 30).
Nichteinsatz von Gerät und Personal begründet noch keinen tatsächlich eingetretenen Schaden
Der bloße Nichteinsatz von Gerät und Personal begründet noch keinen tatsächlich eingetretenen Schaden. Der Geschädigte hat im Einzelnen darzulegen, welche Mehrkosten ihm konkret durch die Behinderung tatsächlich entstanden sind, da nach § 6 Abs. 6 S. 1 VOB/B nur der nachweislich tatsächlich entstandene Schaden zu ersetzen ist und damit es unerlässlich ist, den tatsächlichen Bauablauf darzustellen. Es muss klar sein, ob und welche zusätzlichen Arbeiten überhaupt abgerechnet werden. Es muss klar sein die Kausalität des jeweiligen Störungsfalls für den geltend gemachten Schaden. Erforderlich ist eine Darlegung, weshalb ein anderer Einsatz von Gerät und Personal nicht möglich war oder ob beauftragte Subunternehmer Mehrkosten geltend gemacht haben.
Ohne Darlegung eines tatsächlichen Schadenseintritts Schätzung nach § 287 ZPO durch das Gericht nicht möglich
Wenn es bereits an der grundsätzlichen Darlegung eines tatsächlichen Schadenseintritts mangelt, ist eine Schätzung nach § 287 ZPO durch das Gericht nicht möglich.
Auch die Voraussetzungen für einen Entschädigungsanspruch bzgl. aus „baubetrieblichen Ablaufstörungen“ geltend gemachten Kosten gem. § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B i.V.m. § 642 BGB ist hinreichend darzulegen und zu beweisen. Auch hier ist erforderlich eine Differenzierung zwischen Bauzeitverlängerungen auf Grund vertragsgemäßen und vertragswidrigen Verhaltens der Gegenseite.
Verschuldensunabhängiger Entschädigungsanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B i.V.m. § 642 BGB wenn der Auftraggeber vertragliche Mitwirkungspflichten nicht erfüllt und in Verzug der Annahme kommt
Der Auftragnehmer kann den verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B i.V.m. § 642 BGB geltend machen, wenn der Auftraggeber vertragliche Mitwirkungspflichten nicht erfüllt und in Verzug der Annahme kommt. Die Anwendung von § 642 BGB beim VOB/B-Vertrag führt dazu, dass die „Modalitäten“, nämlich das Erfordernis einer Behinderungsanzeige bzw. der Offenkundigkeit aus § 6 Abs. 6 VOB/B auch auf den Entschädigungsanspruch zu beziehen sind (BGH BauR 2000, 722; BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6). Der Auftragnehmer hat in der Behinderungsanzeige anzugeben, ob und wann seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgeführt werden müssten, nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden können. Die Behinderungsanzeige dient der Information des Auftraggebers über die Störung. Er soll gewarnt und es soll ihm die Möglichkeit gegeben werden, die Behinderung abzustellen (BGHZ 143, 32).
Zweck einer Behinderungsanzeige ist es, den Auftraggeber in die Lage zu versetzen, bzgl. etwaig behindernder Umstände unverzüglich Abhilfe schaffen zu können
Zweck einer Behinderungsanzeige ist es, den Auftraggeber in die Lage zu versetzen, bzgl. etwaig behindernder Umstände unverzüglich Abhilfe schaffen zu können (Informations-, Warn- und Schutzfunktion). Der Auftragnehmer muss daher mitteilen, ob und wann seine Arbeiten nicht bzw. nicht wie vorgesehen ausgeführt werden können, d.h. alle Tatsachen, aus denen sich für den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit und erschöpfend die Behinderungsgründe ergeben, wobei in der Regel eine bauablaufbezogene Darstellung erforderlich ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 28. Februar 2014 – 1-22 U 112/13).
Für jeden Störfall ist substantiiert zur Anspruchshöhe vorzutragen
Der Inhalt des Anspruchs aus § 642 BGB geht dahin, dass der Auftragnehmer über den Ersatz für Mehraufwendungen gem. § 304 BGB hinaus einen Anspruch auf angemessene Entschädigung erhält. Von § 304 BGB werden nur die erforderlichen Mehrkosten während der Zeit des Annahmeverzugs, wie die Kosten für das erfolgslose Anbieten der geschuldeten Leistung sowie Lagergeld für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands, erfasst. Die Höhe der Entschädigung richtet sich einerseits nach der Dauer des Annahmeverzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Auftragnehmer durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. Der Anspruch soll den Auftragnehmer dafür entschädigen, dass er Arbeitskraft und Kapital, z.B. Geräte sowie Verwaltung bereithält und seine zeitliche Disposition durchkreuzt wird. Der Auftragnehmer ist nach allgemeinen Grundsätzen für sämtliche Kriterien, die nach § 642 Abs. 2 BGB die Höhe der Entschädigung bestimmen, in der Darlegungs- und Beweislast. Er muss also darlegen und beweisen, welche Produktionsmittel er wegen Annahmeverzugs des Auftraggebers für welchen Zeitraum nutzlos hat vorhalten müssen (BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6).
Gericht hat festzustellen, inwieweit der Unternehmer während des Annahmeverzugs Produktionsmittel unproduktiv bereitgehalten hat
Das Gericht hat die hierauf entfallenden Anteile aus der vereinbarten Gesamtvergütung zu berücksichtigen, wobei es nach § 287 ZPO zur Schätzung berechtigt ist. Zu den Vergütungsanteilen für die vom Unternehmer unproduktiv bereitgehaltenen Produktionsmittel gehören nicht die infolge des Annahmeverzugs ersparten Aufwendungen einschließlich darauf entfallender Anteile für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn. Im Hinblick auf das Kriterium des anderweitigen Erwerbs hat das Gericht weiterhin zu prüfen, ob der Unternehmer seine Produktionsmittel während des Annahmeverzugs anderweitig – produktiv – eingesetzt hat oder einsetzen konnte. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die anderweitige Einsatzmöglichkeit auf einem sogenannten „echten Füllauftrag“ beruht, also auf einem Auftrag, der nur wegen des Annahmeverzugs angenommen und ausgeführt werden kann. Auf dieser Grundlage hat das Gericht im Rahmen einer Abwägungsentscheidung die angemessene Entschädigung zu bestimmen. Dabei hat es einen Ermessensspielraum, der ihm die Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls ermöglicht (BGH NJW 2020, 1293).
Für sämtliche Störungsfälle ist zu dem Kriterium des anderweitigen Erwerbs hinreichend vorzutragen
Es reicht nicht aus, pauschal auszuführen, dass man das vorgehaltene Personal und die vorgehaltenen Geräte nicht hat anderweitig auf dieser Baustelle hat beschäftigen können.
Insoweit als man Kosten für vorgehaltene Arbeitnehmer von Subunternehmen geltend macht, ist Vortrag erforderlich, ob hierfür überhaupt Mehraufwendungen angefallen sind, was zweifelhaft bleibt, denn es erscheint naheliegend, dass diese vom Subunternehmen anderweitig haben eingesetzt werden können.
Für Ansprüche aus § 2 Abs. 5 oder aus § 2 Abs. 6 VOB/B sind folgende Voraussetzungen auf der Rechtsfolgenseite erforderlich: Als Rechtsfolge der Änderungsanordnung des Auftraggebers ergibt sich die Neuermittlung des Preises für die von der Änderung betroffene Leistung.
Neuermittlung des Preises hat, soweit die vorkalkulatorische Preisfortschreibung maßgeblich ist, von der Leistungsposition auszugehen, die geändert wird
Ein Heranziehen einer anderen, inhaltlich mit der geänderten Leistung identischen Bezugsposition zur Preisfortschreibung der geänderten Leistungsposition ist nur dann und auch nur insoweit zulässig, als die geänderte Leistung Auswirkungen auf Kostenelemente enthält, die nur in der anderen Bezugsposition enthalten sind. Sind Kostenelemente demgegenüber nur modifiziert worden, muss die Kalkulation des Ausgangspreises herangezogen werden, um die dort erfassten kalkulatorischen Ansätze auch für die geänderte Leistung beizubehalten. Es ist demgegenüber unzulässig, eine andere, inhaltlich die geänderte Leistung erfassende Bezugsposition heranzuziehen, da dem Auftraggeber die Vorteile (und Nachteile) der Kalkulation der ursprünglichen Leistungsposition erhalten bleiben müssen (BGH NZBau 2013, 366).
Soweit der Auftragnehmer aufgrund geänderter Leistungen eine Mehrvergütung geltend machen will, ist er für die gesamte Ermittlung des geänderten Preises darlegungs- und beweispflichtig.
Auftragnehmer muss beweisen, dass eine Leistungsänderung vorliegt, welche Mehr- und Minderkosten entstanden sind und im Falle der Maßgeblichkeit der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung, welche Maßgaben die Urkalkulation des Vertragspreises insoweit beinhaltet
Schließlich muss er auch die Anordnung des Auftraggebers nachweisen (BeckOK VOB/B/Kandel, 41. Ed. 31.10.2020, VOB/B § 2 Abs. 5 Rn. 99-101).
Erforderlich ist ein schlüssiger Vortrag zur Anspruchshöhe bzw. zu den Grundlagen der neuen Preisermittlung.
Eine bloße eigene Aufstellung ist keine vorkalkulatorische Preisfortschreibung.
Erforderlich ist schriftsätzlicher Vortrag hierzu, um die Entwicklung aus der Kalkulation darzustellen.
Erforderlich ist die Darstellung eines Bezugs zum Leistungsverzeichnis bzw. der Urkalkulation.
Unmöglich ist ein ungeordnetes Hineinkopieren von Anlagen, d.h. Belegen, klägerseits erstellter Tabellen etc.
Erforderlich ist ein verständlicher, geordneter erklärender schriftsätzlicher Vortrag.
Differenzierung nach vertragsgemäßen Anordnungen und nach vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers für die Bauzeitverlängerung
Erforderlich ist eine Differenzierung nach vertragsgemäßen Anordnungen und nach vertragswidrigen Eingriffen des Auftraggebers für die Bauzeitverlängerung. Dies gilt umso mehr, wenn man neben dem ursprünglichen Auftrag innerhalb der vereinbarten Vertragszeit nachträglich erteilte Zusatzaufträge in erheblichem Umfang mit ausgeführt hat. Auch hier ist nachvollziehbar darzulegen, dass diese Zusatzarbeiten, die gesondert abgerechnet wurden, nicht mitursächlich für die Verlängerung der Gesamtbauzeit waren. Nur dann fehlt es nicht insgesamt an einer plausiblen Darlegung, ob bzw. in welchem Umfang die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung durch eine andere Anordnung des Auftraggebers i.S. des § 2 Nr. 5 VOB/B geändert wurden, die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch gem. § 6 Nr. 6 VOB/B oder für einen Entschädigungsanspruch gem. § 642 BGB vorliegen.
Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch bzgl. der in dem Nachtrag geltend gemachten Kosten gem. § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B müssen hinreichend dargelegt und mit Beweisangeboten versehen werden
Insbesondere ist die Darstellung des konkreten Schadens schlüssig zu gestalten. Zu ersetzen ist aber nur der dem Geschädigten wirklich entstandene Schaden (BGH NJW 1986, 1684 BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6 Rn. 29, 30). Eine abstrakte Zuordnung und Schadensberechnung bei dem der vom Auftragnehmer bei der Kalkulation zugrunde gelegte Bauablauf (Soll 1) dem sog. „störungsmodifizierten“ Bauablauf (Soll 2) ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Bauablaufs gegenübergestellt wird, ist somit für den Schadensnachweis nur bedingt geeignet, da damit nur eine verallgemeinernde, vom Einzelfall losgelöste, letztlich weitgehend fiktive Berechnungsmethode herangezogen wird (BGH NJW 1986, 1684; BGH NZBau 2002, 381; BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6 Rn. 29, 30).
Voraussetzungen für einen Entschädigungsanspruch bzgl. der in einem Nachtrag „baubetriebliche Ablaufstörung“ geltend gemachten Kosten gem. § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B i.V.m. § 642 BGB müssen hinreichend dargelegt und bewiesen werden
Auch hier geht nichts ohne eine Differenzierung zwischen Bauzeitverlängerungen auf Grund vertragsgemäßen und vertragswidrigen Verhaltens der Gegenseite.
Die Mehrkosten für die wiederholte Beantragung der Zutrittsberechtigung gehören nicht zu dem von § 642 BGB abgedecktem Anspruchsumfang, da der Anspruch den Auftragnehmer dafür entschädigen soll, dass er Arbeitskraft und Kapital, z.B. Geräte, sowie Verwaltung bereithält und seine zeitliche Disposition durchkreuzt wird (BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6). Der Auftragnehmer muss also darlegen und beweisen, welche Produktionsmittel er wegen Annahmeverzugs des Auftraggebers für welchen Zeitraum nutzlos hat vorhalten müssen (BeckOK VOB/B/Oberhauser, 41. Ed. 30.4.2020, VOB/B § 6 Abs. 6).