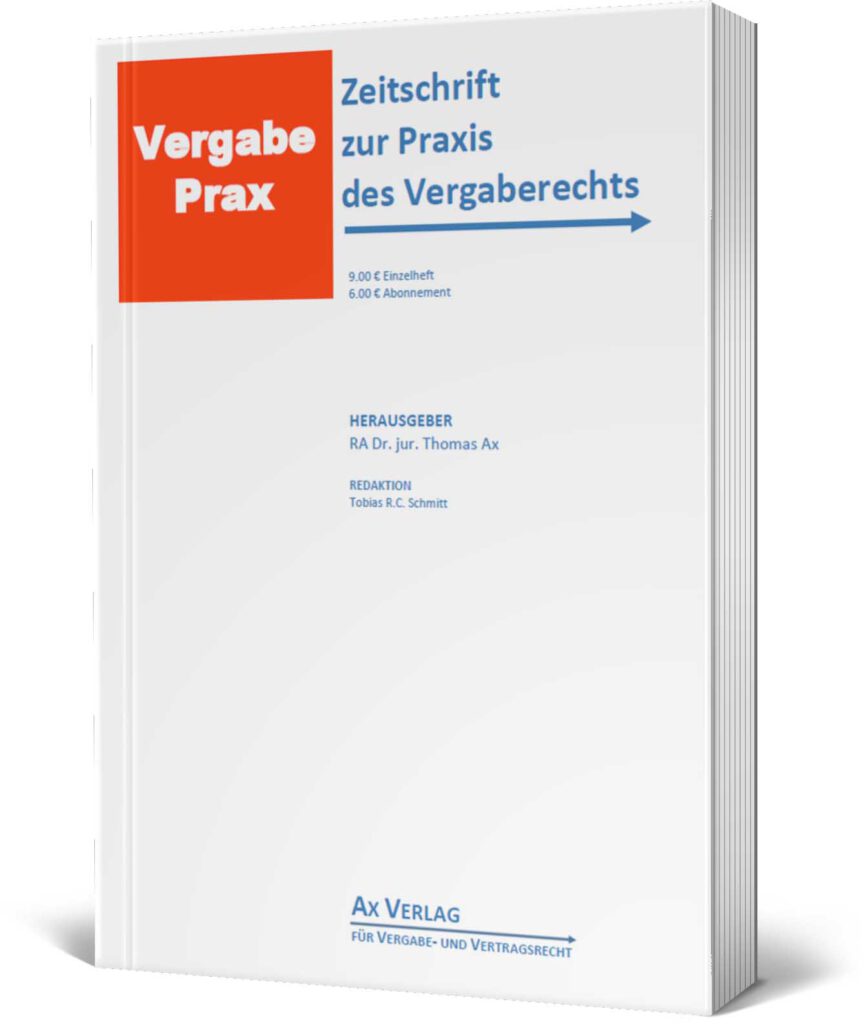vorgestellt von Thomas Ax
Zweifel an der Neutralität des Auftragsnehmers bei der Ausführung des Auftrags und die damit einhergehende Verneinung der beruflichen Leistungsfähigkeit begründen einen fakultativen Ausschlusstatbestand auf der Eignungsebene.
Der Nachweis, dass kein Interessenkonflikt vorliegt, kann grundsätzlich durch eine Eigenerklärung geführt werden.
Bei der Feststellung widersprechender Interessen, die geeignet sind die spätere Auftragsausführung nachteilig zu beeinflussen, hat der Auftraggeber aufgrund ihrer prognostischen Natur einen nur eingeschränkt auf fehlerhafte Tatsachenwürdigung überprüfbaren Beurteilungsspielraum und hinsichtlich der Rechtsfolge Ermessen. Tatbestandlich genügt der Nachweis einer abstrakten Gefahr, die allerdings nicht nur rein theoretischer Natur sein darf.
VK Bund, Beschluss vom 27.06.2025 – VK 1-48/25 (nicht bestandskräftig; Rechtsmittel: OLG Düsseldorf, Az. VII Verg 30/25)
Gründe
I.
1. Die Antragsgegnerin führt derzeit ein europaweites offenes Verfahren zur Vergabe […] durch. Die Leistungen sind für die Jahre 2026 und 2027 ausgeschrieben sowie optional in den Jahren 2028 und 2029. Die Angebotsfrist lief ursprünglich bis zum 27. Mai 2025 und wurde während des Vergabeverfahrens zunächst bis zum 9. Juli 2025 verlängert.
Mit dem Inkrafttreten des novellierten Postgesetzes am 19. Juli 2024 wurde die Deutsche Post AG (DP AG) zur Erbringung des Universaldienstes (§ 15 Abs. 2 Nr. 1 PostG) und zur Einhaltung […] verpflichtet. Für den Fall der Nichteinhaltung ist […] ein Bußgeldtatbestand in […] eingeführt worden. Der Antragsgegnerin wurde […] unter Berücksichtigung anerkannter Standards durchzuführen […]). Vor Inkrafttreten hatte sich die DP AG freiwillig bereit erklärt, die Qualitätskriterien nach der (damaligen) Post-Universaldienstleistungsverordnung […] einzuhalten. Sie war von der Antragsgegnerin verpflichtet worden, über die Qualität der Briefbeförderung zu berichten […] gemäß der […] zu übermitteln. […] erfolgten durch von der DP AG beauftragte externe Unternehmen wie die Antragstellerin.
In der vorliegenden Ausschreibung hat die Antragsgegnerin in Anlage 05 Eignungskriterien unter Nr. 3.4 geregelt:
“Eigenerklärung Unabhängigkeit
Hohe Anforderungen bestehen an die Unabhängigkeit des zu beauftragenden Unternehmens. Diese Anforderungen gelten auch für möglicherweise im Rahmen des Auftrags mit dem Auftragnehmer kooperierende Unternehmen bzw. Institutionen.
Die Glaubwürdigkeit […] können nur durch eine vollständige Unabhängigkeit des Auftragnehmers (Unternehmen, das […] durchführt) erzielt werden. Jeglicher Anschein eines Interessenskonfliktes des Auftragnehmers zur Durchführung […] ist auszuschließen. Die […] verlangt eine unabhängige Leistungskontrolle von Stellen, die nicht mit den Anbietern von Universaldienstleistungen verbunden sind (vgl. Art. 16 Abs. 4).
Die vollständige Unabhängigkeit des Auftragnehmers setzt zunächst “ein für die Überwachung ([…]) verantwortliches Organ (hier Auftragnehmer), das (der) außerhalb des überwachten Postbetreibers angesiedelt ist und zu diesem in keinem Eigentums- oder Kontrollverhältnis ‘steht”, voraus ([…]). Auftragnehmer und Universaldienstanbieter dürfen daher keine verbundenen Unternehmen im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 […]
Unabhängigkeit bedeutet zudem, dass der Auftragnehmer […] im Auftrag des Universaldienstleisters (oder im Auftrag eines mit dem Universaldienstanbieter verbundenen Unternehmens) durchführt [Hervorhebung durch die VK]. Nur so kann jeglicher Anschein eines Interessenkonflikts vermieden und die Glaubwürdigkeit […] sichergestellt werden.
Führt der Auftragnehmer zwar keine vergleichbaren […] für den Universaldienstleister durch, bestehen aber andere vertragliche Beziehungen, so ist sicherzustellen, dass […] organisatorisch, personell und funktional getrennt (“berührungsfrei”) von der Erfüllung der vertraglichen Pflichten gegenüber dem Universaldienstleister erfolgt. Es darf kein Abfluss von Informationen […] werden, an den Universaldienstleister stattfinden. ‘Ggf. ist durch Informationsbarrieren (“Chinese Walls”) zu gewährleisten, dass kein Informationsfluss zwischen den Organisationsbereichen erfolgt. Der Auftragnehmer muss darlegen, wie die Trennung erfolgen soll und mit welchen Maßnahmen ein möglicher Interessenskonflikt ausgeschlossen werden kann.
Kann ein Interessenskonflikt durch die im Angebot dargelegten Maßnahmen nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, führt dies zum Ausschluss aus bzw. zur Nichtberücksichtigung im weiteren Vergabeverfahren.
Bestätigen Sie, dass die Unabhängigkeit im Rahmen der Leistungserbringung gegeben ist.
Bitte bestätigen Sie außerdem, dass Sie sich derzeit oder in Zukunft nicht in einem scheinbaren, potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit dem betreffenden Vergabeverfahren befinden oder geraten könnten und diese Anforderungen bis Vertragsende eingehalten werden.“
Die Antragstellerin ist nach eigenen Angaben auf dem Markt […] für Postdienstleister sowohl in Deutschland als auch weltweit tätig. Sie führt – von der DP AG gesellschaftsrechtlich unabhängig – seit 2001 und auch im Jahr 2025 […] für diese durch. Sie rügte mit Schreiben vom 16. Mai 2025 die “Eigenerklärung Unabhängigkeit” als vergaberechtswidrig.
Die Antragsgegnerin änderte daraufhin die Anforderung in Ziffer 3.4, Absatz 4:
“Unabhängigkeit bedeutet zudem, dass der Auftragnehmer während der Vertragsausführung [Hervorhebung durch die VK] […] im Auftrag des Universaldienstleisters (oder im Auftrag eines mit dem Universaldienstanbieter verbundenen Unternehmens) durchführt. Nur so kann jeglicher Anschein eines Interessenkonflikts vermieden und die Glaubwürdigkeit […] sichergestellt werden.“
Sie teilte dies am 20. Mai 2025 über den Bieterfragenkatalog, Frage Nr. 8 (Anlage 05, Eignungskriterien / Klarstellung des Eignungskriteriums 3.4) mit:
“In der Anlage 05_Eignungskriterien_V2.xlsx wurde das Eignungskriterium 3.4 um den Zusatz “während der Vertragsausführung” ergänzt (s. rote Markierung).
Da es sich hierbei nicht um eine grundlegende Änderung, sondern um eine Klarstellung der Vergabeunterlagen handelt, erfolgt keine Anpassung der Angebotsfrist.
Für die Angebotsabgabe ist zwingend die aktualisierte Anlage 05 zu verwenden.“
Am 21. Mai 2025 erhielt die Antragstellerin ein Nichtabhilfeschreiben der Antragsgegnerin.
2. Die Antragstellerin beantragte mit Schreiben ihrer Verfahrensbevollmächtigten am 26. Mai 2025 bei der Vergabekammer des Bundes die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag wurde am nächsten Tag an die Antragsgegnerin übermittelt.
a) Der Nachprüfungsantrag ist nach Auffassung der Antragstellerin zulässig. Sie sei antragsbefugt. Sie sei aus tatsächlichen Gründen nicht in der Lage, die geforderte Erklärung abzugeben, wonach sie sich “derzeit” oder in Zukunft nicht in einem scheinbaren., potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit dem betreffenden Vergabeverfahren befinde oder geraten könne. Derzeit sei die Antragstellerin noch […] für die DP AG tätig. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie in künftigen Jahren von der DP AG beauftragt werde. Sie habe daher ein legitimes Interesse an der Sicherstellung vergaberechtskonformer Anforderungen an die Unabhängigkeit von Bietern.
Der Nachprüfungsantrag sei begründet. Erstmals in der Erwiderung zum Nachprüfungsantrag stütze sich die Antragsgegnerin auf § 46 Abs. 1 VgV und überdehne dessen Anwendungsbereich. Die Qualität der Laufzeitmessung sei keine statthafte Anforderung an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit im Sinne des § 46 Abs. 1 VgV. Nur die in § 46 Abs. 3 VgV abschließend aufgeführten Belege stünden zum Nachweis zur Verfügung.
Die Verneinung der beruflichen Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 2 VgV als Prognoseentscheidung sei fehlerhaft. § 46 Abs. 2 VgV erfordere, dass der Auftraggeber eine sachlich nachvollziehbar begründete Gefahr eines Interessenkonfliktes darlege. Eine rein theoretische Gefahr genüge nicht. Die Antragsgegnerin stelle im Hinblick auf die “nachteilige Beeinflussung” nicht auf eine “abstrakte Gefahr” ab, sondern auf eine willkürliche Fiktion. Sie etabliere den Maßstab der “absoluten Sicherheit“. Die Fiktion des “bösen Anscheins” verkenne die objektiv nach […] gegebene auftragsspezifische Interessenlage und sei beurteilungsfehlerhaft. Die Antragsgegnerin leite das aus dem Adjektiv der “unabhängigen” […] in der Gesetzesbegründung ab, während sich der Begriff im Wortlaut des […]nicht wiederfinde. Die in der Postdienste-Richtlinie aufgeführte Unabhängigkeit der Leistungskontrollen von Stellen, die nicht mit den Anbietern von Universaldienstleistungen verbunden sind ([…]), werde von der Antragsgegnerin auch auf “wirtschaftliche Verbindungen” erstreckt. Maßstab könne aber nur die gesellschaftsrechtliche Unabhängigkeit und die Geheimhaltung […] sein. Auch der Maßstab der Neutralität sei erstmals mit der Antragserwiderung aufgegriffen worden. Die Statuierung der Qualitätsanforderung “keine Parallelmessung für Universaldienstanbieter” sei intransparent. Warum ein Auftrag für die Antragsgegnerin nicht neutral sein könne, werde nicht ausgeführt. Es werde nicht dargelegt, was die auftragserforderliche Qualität in Person […] sachlich positiv auszeichne.
Zwar habe die Antragsgegnerin den Zusatz “während der Vertragsausführung” eingefügt, verlange aber vom Bieter sich “derzeit” nicht in einem scheinbaren, potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt zu befinden. Es werde nicht eindeutig klar, welche Anforderungen an die Unabhängigkeit zu erfüllen seien. Die Antragsgegnerin habe es unterlassen, ein auftragsschädliches Interesse bei der parallelen Durchführung […] in Bezug auf den ausgeschriebenen Auftrag konkret festzustellen. Die Antragsgegnerin berufe sich lediglich auf eine “Sorge” vor einem möglichen Fehlverhalten. Das auftragsspezifische Interesse von Bietern bestehe indes darin, einen unzweifelhaften Leumund als Anbieter – und Garant – unabhängiger Leistungskontrollen aufzubauen und zu bewahren. Die methodologische “Unbestechlichkeit” sei geschäftspolitische Notwendigkeit. Dies zeige auch die anzuwendende […], die […] definiere. Die Richtlinie […] fordere hinsichtlich der Unabhängigkeit des Kontrolleurs, dass dieser nicht mit dem betreffenden Universaldienstleister im- gesellschaftsrechtlichen Sinne verbunden sein dürfe. Die Vergabeunterlagen gingen über diese Anforderung aber hinaus. Die Argumentation der Antragsgegnerin hinsichtlich des […] Bußgeldtatbestand […] sei nicht tragfähig. Der unabhängigen Leistungsüberwachungsorganisation, also dem Auftragnehmer, seien in […] der Norm bestimmte Vorgaben an die Unabhängigkeit gemacht. Die Norm sehe sehr konkrete Maßnahmen vor, um […] von jeglicher Einflussnahme durch den betreffenden Postbetreiber zu entkoppeln. Auch werde nach der […] die Rolle des Dienstleisters als Stelle außerhalb des Einflussbereiches des Postbetreibers definiert. Im Gesetzgebungsverfahren hätten keine Zweifel an der […] bestanden. Dort sei keine Notwendigkeit gesehen worden, die Anforderungen an […] in irgendeiner Weise zu verschärfen.
Die Antragsgegnerin habe es selbst in der Hand, wie sie das von ihr beauftragte […] gestalte. Das betreffende […] würde zwei unterschiedliche und vollständig voneinander unabhängige […] durchführen. Es sei nicht ersichtlich, warum ein eventueller Wettbewerbsvorteil aufgrund von Skaleneffekten (mögliche Quersubventionierung) zu Zweifeln an der Unabhängigkeit der Durchführung des Auftrags führen sollte. Auch der Aspekt […] habe keinen sachlichen Zusammenhang mit den festzustellenden auftragsschädlichen Interessen eines Bieters gemäß § 46 Abs. 2 VgV.
Die Möglichkeit der Widerlegung des bösen Anscheins werde dem Bieter nur bei “anderen vertraglichen” Beziehungen ermöglicht. Dies benachteilige Unternehmen, […], unverhältnismäßig, weil ihnen gerade keine solche Möglichkeit eingeräumt werde. Ferner sei nicht einleuchtend, nach welchen Maßstäben unabhängigkeitsschädliche vertragliche Beziehungen […] von unabhängigkeitsunschädlichen sonstigen vertraglichen Beziehungen abgegrenzt würden. Das zu schützende […] durch die EN Norm determiniert, so dass eine Unterscheidung zu unschädlichen sonstigen vertraglichen Beziehungen sachlich ungerechtfertigt sei.
Es liege ein Dokumentationsmangel hinsichtlich der Formulierung der Eignungsanforderungen vor.
Die Antragstellerin beantragt über ihre Verfahrensbevollmächtigten:
1. die Antragsgegnerin zu verpflichten, das Eignungskriterium “Unabhängigkeit” gemäß 3.4 der “Anlage 05_Eignungskriterien_V2” der bekanntgemachten Vergabeunterlagen dahingehend abzuändern, dass ein bloßes Tätigwerden eines Bieters für den Universaldienstleister Deutsche Post AG in der Weise, dass ein Bieter ohne von ihm auf gesellschaftsrechtlicher Basis beherrscht oder kontrolliert zu werden, nicht zur Verneinung der beruflichen Leistungsfähigkeit des Bieters wegen mangelnder Unabhängigkeit des zu beauftragenden Unternehmens führt,
2. hilfsweise zu 1: die Antragsgegnerin zu verpflichten, einem Bieter, der für den Universaldienstleister Deutsche Post AG […], ohne von diesem auf gesellschaftsrechtlicher Basis beherrscht oder kontrolliert zu werden, die Möglichkeit einzuräumen, im Rahmen der Darlegung seiner beruflichen Leistungsfähigkeit den Nachweis zu erbringen, dass und aufgrund welcher betriebsinternen Maßnahmen er für die Antragsgegnerin trotz der Tätigkeit für den Universaldienstleister verwertbare und nicht zu beanstandende […] im Auftrag der Antragsgegnerin meint durchführen zu können,
3. die Antragsgegnerin zu verpflichten, das Vergabeverfahren in den Stand vor Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zum Eignungskriterium der Unabhängigkeit gemäß Anträgen zu 1. und 2. zurückzuversetzen,
4. hilfsweise zu 3: die Antragsgegnerin zu verpflichten, nach Änderung des Eignungskriteriums “Unabhängigkeit” gemäß Anträgen zu 1. und 2. die Frist zur Angebotsabgabe angemessen zu verlängern bzw. der Antragstellerin eine angemessene Frist zu Nachreichung eines Angebotes einzuräumen,
5. die Vergabeakten der Antragsgegnerin beizuziehen und der Antragstellerin Akteneinsicht gemäß § 165 GWB zu gewähren,
6. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der Antragstellerin aufzuerlegen sowie
7. festzustellen, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für die Antragstellerin für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig gewesen ist.
b) Die Antragsgegnerin beantragt,
die Anträge zurückzuweisen.
Der Nachprüfungsantrag sei nicht begründet. Das Eignungskriterium 3.4 sei vergaberechtskonform formuliert. § 46 Abs. 1 und 2 VgV präzisierten das Kriterium der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit.
Das Eignungskriterium der Unabhängigkeit stelle ein Qualitätskriterium i.S.d. § 46 Abs. 1 Satz 1 VgV dar. Es gebe dem Auftraggeber die Möglichkeit, Anforderungen zu stellen, um die Gewähr dafür zu haben, dass die Unternehmen hinreichend geeignet seien, den Auftrag in angemessener Qualität auszuführen. Die Anforderungen ergäben sich hier aus dem […]. Ein Unternehmen, dass im Vertragszeitraum auch im Auftrag des Universaldienstanbieters […], könne die nach dem […] verlangte Qualität nicht erbringen. […] anerkannter Standards zu überprüfen. Nach der Gesetzesbegründung sei hiermit eine unabhängige […] gemeint. Eine Auslegung des Unabhängigkeitserfordernisses ergebe, dass der beauftragte […] nicht gleichzeitig während der Vertragslaufzeit […] im Auftrag des Universaldienstanbieters durchführe. Nach der Gesetzesnovelle bilde die Beauftragung […] einen zentralen Bestandteil bei […]. Mit der Verortung […]habe der Gesetzgeber offensichtlich die Absicht verbunden, jeglichen Anschein eines Zweifels an der Objektivität […] von vornherein auszuschließen. Er habe mit seiner Entscheidung gegen den Status quo besonders hohe Anforderungen an die Unabhängigkeit […]gesetzt, um die Glaubwürdigkeit und das
Vertrauen in die Integrität und Objektivität […] sicherzustellen. Dies werde dadurch bestätigt, dass der Gesetzgeber den Universaldienstanbieter verpflichte, […]. Er gehe augenscheinlich von separaten, vollständig […].
Auch […] könne herangezogen werden. Danach sei […] von Stellen durchzuführen, die nicht mit dem Anbieter von Universaldienstleistungen verbunden seien. Diese Voraussetzungen (“unabhängig“, “nicht verbunden“) müssten kumulativ vorliegen. Um den Aspekt “Unabhängigkeit” zu verneinen, genügten wirtschaftliche Verbindungen, die geeignet seien, das Vertrauen in die Integrität und die Objektivität […] zu beeinträchtigen. Eine andere Beurteilung ergebe sich auch nicht aus der […] (einschließlich der […], in den entscheidungserheblichen Fragen gleichlautend), wonach die unabhängige Leistungsüberwachungsorganisation als “Organ, das mit der Überwachung der Dienstqualität entsprechend der in dieser Norm festgelegten Methodologie betraut ist, außerhalb des überwachten Postbetreibers angesiedelt ist und zu diesem in keinem Eigentums- oder Kontrollverhältnis steht” definiert werde. Eine technische Norm könne nationale und europäischen Gesetze nicht verdrängen. Die […] enthalte zudem lediglich Mindestanforderungen. Dort werde ausgeführt, dass die Glaubwürdigkeit […] nur durch die vollständige Unabhängigkeit der Leistungsüberwachungsorganisation erzielt werden könne (Anhang […]). Dies könne nur gewährleistet werden, wenn […] im Auftrag des Universaldienstleisters ausgeschlossen sei.
Bei einer parallelen […] sei auch die abstrakte Gefahr eines Interessenkonflikts gemäß § 46 Abs. 2 VgV gegeben. Der Auftraggeber könne die berufliche Leistungsfähigkeit verneinen, wenn er bereits im Vergabeverfahren feststelle, dass ein Bieter oder Bewerber Interessen habe, die mit der Ausführung des Auftrags im Widerspruch stehen und dessen Ausführung nachteilig beeinflussen können. Es handele sich um einen fakultativen Ausschlusstatbestand. Vorliegend lägen Anhaltspunkte für eine zumindest abstrakte Gefahr vor. Ein paralleles Tätigwerden bringe einen klaren Wettbewerbsvorteil (Quersubventionierung) für das Unternehmen mit sich. Ein solcher Vorteil könne nur mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, wenn eine […] von vornherein ausscheide. Eine Verwendung auch nur von […] für beide Aufträge (Skaleneffekte) stelle einen wirtschaftlichen Nachteil für andere, unabhängige Bieter dar. Auch die individuelle Gestaltung […] könne den Interessenkonflikt nicht auflösen. Dieser leite sich aus der wirtschaftlichen Beziehung mit dem Universaldienstanbieter ab. […] bliebe auch […] derselbe. Im Fall divergierender […] würde die […] erheblich beeinträchtigt. […] Das
Eignungskriterium sei auch verhältnismäßig. Bei einer abstrakten Gefahr sei gerade keine Einzelfallprüfung erforderlich. Eine reine Trennung i.S.v. “Chinese Walls” sei offensichtlich nicht ausreichend, um den Anschein zu vermeiden. Die […] lasse es ausdrücklich zu, den besonderen nationalen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Bei den in […] genannten Aspekten handele es sich nicht um einen abschließenden Katalog für die “vollständige Unabhängigkeit der Leistungsüberwachungsorganisation“. Der Wortlaut spreche für eine beispielhafte Auflistung. Der […] habe nur informativen Charakter.
Das Kriterium sei auch hinreichend klar. Die Ausschreibungsunterlagen konnten bereits vor der Klarstellung analog §§ 133, 157 BGB so verstanden werden, dass ein Bieter zum Zeitpunkt des Auftragsbeginns und in Zukunft in keinem Interessenkonflikt stehen solle. Dies sei in der Formulierung “Bestätigen Sie, dass die Unabhängigkeit im Rahmen der Leistungserbringung gegeben ist” deutlich geworden. Durch die Korrektur in Ziffer 3.4 habe die Antragsgegnerin schließlich potentielle Unklarheiten aus dem Weg geräumt. Die Klarstellung sei nicht zwingend geboten gewesen, aber sinnvoll. Die Formulierung “derzeit” beziehe sich nicht auf den Nachweis der Unabhängigkeit […] auf sonstige Interessenkonflikte.
Die Vergabekammer hat der Antragstellerin Einsicht in die Vergabeakten gewährt, soweit diese entscheidungserheblich und nicht geheimhaltungsbedürftig waren.
In der mündlichen Verhandlung am 24. Juni 2025 hatten die Beteiligten Gelegenheit, ihre Standpunkte darzulegen und mit der Vergabekammer umfassend zu erörtern. Nach der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin die Frist zu Angebotsabgabe noch einmal bis zum 15. Juli 2025 verlängert.
Auf die ausgetauschten Schriftsätze, die Verfahrensakte der Vergabekammer sowie auf die Vergabeakten, soweit sie der Vergabekammer vorgelegt würden, wird ergänzend Bezug genommen.
II.
Der zulässige Nachprüfungsantrag ist unbegründet.
1. Der Nachprüfungsantrag ist zulässig.
Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Ihr Auftragsinteresse im Sinne des § 160 Abs. 2 GWB hat sie durch ihre Rüge belegt. Die Rechtsverletzung hat sie dadurch hinreichend begründet, dass sie die von der Antragsgegnerin aufgestellte Eignungsanforderung in Form der Eigenerklärung nach Ziffer 3.4 als fehlerhaft ansieht und eine Angebotsabgabe ihr infolgedessen nicht möglich erscheint. Sie rügte mit Schreiben vom 16. Mai 2025 die “Eigenerklärung Unabhängigkeit” als vergaberechtswidrig. Diese Rüge ist rechtzeitig gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB spätestens bis zur Frist zur Angebotsabgabe erfolgt. Nach der Nichtabhilfe der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 21. Mai 2025 hat die Antragstellerin rechtzeitig gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen den Nachprüfungsantrag eingereicht.
2. Der. Nachprüfungsantrag ist unbegründet. Die von der Antragsgegnerin in Ziffer 3.4 vorgesehenen Anforderungen an die Unabhängigkeit des zu beauftragenden Unternehmens in der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” sind als Eignungskriterium gemäß § 46 Abs. 2 VgV anzusehen (siehe unter lit. a). Die Antragsgegnerin hat ihren Beurteilungsspielraum bei der Festlegung des Umfangs der Eigenerklärung nicht überschritten (unter lit. b). Die Antragsgegnerin hat die notwendige Dokumentation der Eignungsanforderungen gemäß § 8 VgV nachgeholt (lit. c).
a) Die von der Antragsgegnerin in Ziffer 3.4 vorgesehenen Anforderungen an die Unabhängigkeit des zu beauftragenden Unternehmens in der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” sind als Eignungskriterium gemäß § 46 Abs. 2 VgV im Rahmen der beruflichen Leistungsfähigkeit anzusehen. Danach kann der öffentliche Auftraggeber die berufliche Leistungsfähigkeit eines Bewerbers verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen hat, die mit der Ausführung des öffentlichen Auftrags im Widerspruch stehen und sie nachteilig beeinflussen können.
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin liegt in der Feststellung von Interessenkonflikten aufgrund der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” keine Anforderung im Sinne eines Qualitätskriteriums nach § 46 Abs. 1 VgV. Danach kann der öffentliche Auftraggeber materielle Anforderungen an die berufliche Leistungsfähigkeit stellen, die sicherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforderlichen personellen und technischen Mittel sowie ausreichende Erfahrungen verfügen, um den Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können. Hierfür stehen ihm allein die in § 46 Abs. 3 VgV abschließend aufgeführten Belege zur Verfügung (vgl. Goldbrunner in ZiekowNöllink, Vergaberecht, 5. Aufl. 2024, § 46 VgV, Rn. 11). Gegen die Bewertung als Qualitätskriterium spricht bereits, dass sich ein entsprechender Beleg der beruflichen Leistungsfähigkeit in Form einer Eigenerklärung zu Interessenkonflikten dort gerade nicht findet. Tatsächlich ergibt sich aus Art. 58 Abs. 4 Unterabsatz 2 Satz 2 der Vergabe-Richtlinie 2014/24/EU, der in § 46 Abs. 2 VgV umgesetzt wurde, die Regelung eines gesonderten fakultativen Ausschlussgrunds bei Interessenkonflikten. Danach räumt der (EU- und der nationale) Gesetzgeber einem öffentlichen Auftraggeber die Befugnis ein, Bewerber oder Bieter mangels beruflicher Leistungsfähigkeit ausschließen zu können, wenn er “festgestellt hat“, dass ein Interessenkonflikt besteht. Die Regelung zielt darauf ab, dem Auftraggeber eine Handlungsoption zu eröffnen, wenn er bereits im Vergabeverfahren feststellt, dass ein Bieter oder Bewerber Interessen hat, die mit der Ausführung des Auftrags im Widerspruch stehen und dessen Ausführung nachteilig beeinflussen können. Es wäre mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und dem öffentlichen Interesse an einer effizienten und ausschreibungskonformen Erbringung öffentlicher Aufträge nicht zu vereinbaren, wenn der öffentliche Auftraggeber gezwungen wäre, einen Auftrag an einen solchen Bieter zu vergeben und dabei sehenden Auges nachteilige Auswirkungen für die Leistungserbringung zu riskieren. Zweifel an der Neutralität des Auftragsnehmers bei der Ausführung des Auftrags und die damit einhergehende Verneinung der beruflichen Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 2 VgV begründen daher einen (fakultativen, d.h. in das Ermessen der Vergabestelle gestellten) Ausschlusstatbestand auf der Eignungsebene (so im Ergebnis auch VK Bund, Beschluss vom 14. Mai 2018, VK 1-39/18). Der Nachweis, dass kein Interessenkonflikt vorliegt, kann grundsätzlich durch eine Eigenerklärung gemäß § 48 Abs. 2 Satz 1 VgV geführt werden (vgl. Goldbrunner in ZiekowNöllink, § 46 VgV, Rn. 10, siehe zu einer Neutralitätsverpflichtung als Eignungskriterium: VK Bund, Beschluss vom 30. Juli 2018, VK1-61/18).
b) Die Antragsgegnerin hat ihren Beurteilungsspielraum bei der Festlegung des Umfangs der Eigenerklärung nicht überschritten, indem sie in der (aufgrund der Rüge der Antragstellerin ergänzten) “Eigenerklärung Unabhängigkeit” fordert, der Auftragnehmer dürfe während der Vertragsausführung für die Antragsgegnerin keine […] im Auftrag des Universaldienstleisters durchführen.
Bei der Festlegung der Eignungsanforderungen hat der öffentliche Auftraggeber einen Festlegungsspielraum. Entscheidend ist, ob aus Sicht der Vergabestelle ein berechtigtes Interesse an der im Verfahren aufgestellten Forderung besteht, so dass diese als sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig erscheint und den Bieterwettbewerb nicht unnötig einschränkt. Der öffentliche Auftraggeber darf daher diejenigen Anforderungen an den Nachweis stellen, die zur Sicherstellung des Erfüllungsinteresses erforderlich sind, die mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen und die nicht unverhältnismäßig, nicht unangemessen und für den Bieter nicht unzumutbar sind. Bewertungsmaßstab für die Angemessenheit ist der Gegenstand des Auftrags, wie er in den Vergabeunterlagen zum Ausdruck kommt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28. Juni 2023, VII-Verg 48/22 m.w.N.).
Die Anforderungen an die Unabhängigkeit des Auftragnehmers dienen hier dazu, Interessenkonflikte zu Lasten der Antragsgegnerin im Rahmen der Leistungserbringung auszuschließen. Bei der Feststellung der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 VgV steht dem öffentlichen Auftraggeber ein Beurteilungsspielraum zu, der von den Nachprüfungsbehörden nur dahingehend überprüfbar ist, ob von einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachverhalt ausgegangen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen für die Entscheidung herangezogen wurden und nicht gegen allgemein gültige Bewertungsansätze verstoßen wurde. Ebenso wie bei der Festlegung der Anforderungen an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit nach § 46 Abs. 1 VgV und der Belege zu deren Nachweis nach § 46 Abs. 3 VgV sind auch bei den Anforderungen nach § 46 Abs. 2 VgV die Grundsätze des Wettbewerbs, der Verhältnismäßigkeit und des Auftragsbezugs gemäß §§ 97 Abs. 1, 122 Abs. 4 Satz 1 GWB zu berücksichtigen. Bei der Feststellung widersprechender Interessen gemäß § 46 Abs. 2 VgV, die geeignet sind die spätere Auftragsausführung nachteilig zu beeinflussen, hat der Auftraggeber aufgrund ihrer prognostischen Natur – wie bei anderen fakultativen Ausschlussgründen – einen nur eingeschränkt auf fehlerhafte Tatsachenwürdigung überprüfbaren Beurteilungsspielraum und hinsichtlich der Rechtsfolge Ermessen (vgl. BT-Drs. 18/6281, Regierungsbegründung zum VergRModG, S.104). Nach dem Wortlaut des § 46 Abs. 2 VgV (“nachteilig beeinflussen könnten“) genügt tatbestandlich der Nachweis einer abstrakten Gefahr, die allerdings nicht nur rein theoretischer Natur sein darf (vgl. VK Bund, Beschluss vom 14. Mai 2018, VK 1-39/18). Dies entspricht auch dem Regelungszweck der Norm, die dem Auftraggeber bei einer nachvollziehbar begründeten Gefahr eines Interessenkonflikts die Möglichkeit eröffnen soll, sich nicht auf ein Vertragsverhältnis mit einem Unternehmen einlassen zu müssen, dessen Interessen im Widerspruch zu dem vom Auftraggeber angestrebten Leistungserfolg stehen (vgl. VK Bund, Beschluss vom 14. Mai 2018, VK 1-39/18).
aa) Die Antragsgegnerin hat in ihrem letzten Schriftsatz und in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar dargelegt, dass aus ihrer Sicht eine abstrakte Gefahr in der […] für die Antragsgegnerin und den Universaldienst-Anbieter DP AG besteht. Sie ist damit ihrer Darlegungs- und Beweislast für entsprechende Anknüpfungstatsachen nachgekommen. Sie sieht die Glaubwürdigkeit […] gegenüber der DP AG, wie beispielsweise in einem […] in Gefahr. Insbesondere sieht sie ein konkretes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn beide Seiten sich in einem streitigen Verfahren […]- desselben – Auftragnehmers beziehen. Sie hatte dazu auch bereits in der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” (Abs. 4 Satz 2) zur Begründung der Nichtzulassung von parallelen […] ausgeführt “nur so kann jeglicher Anschein eines Interessenkonflikts vermieden und die Glaubwürdigkeit […] sichergestellt werden.” Die Antragsgegnerin hat sich dabei in sachgerechter Weise auf die normativen Rahmenbedingungen […] bezogen. Dabei handelt es sich um die zugrunde liegende […].
– So regelt […] (Qualität der Dienste), dass […] von Stellen durchzuführen ist, die nicht mit den Anbietern von Universaldienstleistungen verbunden sind”. Nach dem Wortlaut der Norm ist von zwei Tatbestandsmerkmalen, die kumulativ vorliegen müssen, auszugehen: Zum einen von dem strukturellen Tatbestandsmerkmal der gesellschaftsrechtlichen Nicht-Beteiligung der Universaldienstleistungsunternehmens an dem Dienstleister […], zum anderen von dem einzelfallorientierten Tatbestandsmerkmal der “unabhängigen Leistungskontrolle“. Die Antragsgegnerin hat sich hier nachvollziehbar darauf berufen, dass eine unabhängige Leistungskontrolle über die bloße gesellschaftsrechtliche Komponente hinaus gehe und sich auch auf die konkrete Leistungskontrolle beziehe.
– Nach den ins nationale Recht umgesetzten Vorgaben […]. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es […]. Aus der […] ist abzuleiten, dass die […] (damaligen) Post-Universaldienstleistungsverordnung […] werden sollen. Nach wie vor sind aber […]. Im Lichte der Tatsache, dass vom Gesetzgeber […], ist die Entscheidung der Antragsgegnerin, dass die von ihr […] nicht von demselben Dienstleister durchgeführt werden sollen, als sachgerecht anzusehen. Dies ergibt sich gerade auch aus der Tatsache, dass […] durchzuführen sind. Da grundsätzlich […], wäre die Einführung […]- nicht notwendig gewesen. Die Einführung nach […] weist daher auf den Willen des Gesetzgebers hin, dass […] valide […] Daten erhebt, um die […]. Die geforderte Unabhängigkeit bei der Vertragsausführung ist daher auch aus diesem Grund sachgerecht.
– Nichts anderes ergibt sich aus der […]. Diese definiert zwar die “unabhängige Leistungsüberwachungsorganisation” gesellschaftsrechtlich bzw. kontrollrechtlich ([…]). Sie erlegt dieser auch auf, dass sie absichern muss, dass der Postbetreiber […]. Dort heißt es in […] nur durch die vollständige Unabhängigkeit der Leistungsüberwachungsorganisation erzielt werden. Auch bei einer rein wirtschaftlichen Verbindung in Form einer parallelen Beauftragung […] durch zwei Auftraggeber kann eine solche vollständige Unabhängigkeit des Dienstleisters somit zweifelhaft sein und die Glaubwürdigkeit […] (“Diener zweier Herren“) beeinträchtigen. Die Einschätzung der Antragsgegnerin erscheint nachvollziehbar und bewegt sich innerhalb des von der Vergabekammer überprüfbaren Beurteilungsspielraums.
bb) Auch ist die Vorgabe, dass der künftige Auftragnehmer während der Vertragsausführung […] durchführt, gemäß § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB verhältnismäßig. Eignungskriterien müssen danach mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Dies ist vorliegend der Fall. Der Ausschluss einer Exkulpationsmöglichkeit im […] ist im Hinblick auf den von der Antragsgegnerin verfolgten Zweck der Erklärung verhältnismäßig.
Zwar hat die Antragsgegnerin in der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” eine Möglichkeit eröffnet, bei “anderen vertraglichen Beziehungen” mit dem Universaldienstleister zu bestätigen, dass kein Interessenkonflikt besteht. Dort reicht es im Rahmen der schriftlichen Bestätigung aus, dass Vorkehrungen getroffen werden, die einen Informationsabfluss verhindern (“Chinese Walls“). Es handelt sich bei den “anderen vertraglichen Beziehungen” beispielsweise um Zufriedenheitsumfragen, die aus Sicht der Antragsgegnerin nicht in einem direkten Zusammenhang […] stehen. Solche lösen daher nicht von vornherein einen “bösen” Anschein im Sinne der Glaubwürdigkeit […] aus, weil weniger wahrscheinlich ist, dass es zu divergierenden Ergebnissen bei […] kommen kann.
Die Antragstellerin trägt zwar vor, dass aufgrund der strengen Vorgaben der Norm eine […] durch den Auftragnehmer unwahrscheinlich sei. Dieser habe kein Interesse, auftragsschädlich zu agieren. Doch selbst bei einer – […] folgt bei einer Tätigkeit jeweils für beide Auftraggeber nicht zwangsläufig eine Unangreifbarkeit der Ergebnisse aus Sicht der Antragsgegnerin. Im Hinblick auf die nach […] kann es auch […]- so hat es die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung anschaulich erläutert – zu unterschiedlichen Ergebnissen kämmen, […]. Diese würden sich […] zwar “nur” im Rahmen einer statthaften statistischen Abweichung bewegen. Jedoch müsse […] eine Aggregierung, je nach […], erfolgen. Selbst wenn der bei […] zur Qualitätssicherung jeweils tätige Auditor ([…]) die Richtigkeit […] ‘attestiert, ist nicht zwangsläufig von unangreifbaren Ergebnissen auszugehen. Dies gilt gerade für den Fall, dass es zu streitigen Verfahren, beispielsweise […] käme. Das Motiv der Antragsgegnerin, primär die Glaubwürdigkeit […] zu schützen und den Fall von […] von vornherein auszuschließen, ist insoweit sachgerecht. Diesem Interesse würde die Möglichkeit einer “Exkulpierung” oder der Etablierung von Chinese Walls für den Fall des gleichzeitigen Tätigwerdens für denselben Postanbieter, also die DP AG, nicht gleichermaßen gerecht.
cc) Nach der mündlichen Verhandlung ist geklärt, dass sich der Begriff “derzeit” (“Bitte bestätigen Sie außerdem, dass Sie sich derzeit oder in Zukunft nicht in einem scheinbaren, potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit dem betreffenden Vergabeverfahren befinden oder geraten könnten und diese Anforderungen bis Vertragsende eingehalten werden.“) nur auf die “anderen vertraglichen Beziehungen” (siehe dazu oben lit. bb) der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” bezieht. Die Antragstellerin ist daher nicht gehindert, trotz ihrer derzeit noch andauernden Tätigkeit für die DP AG bei einer Beendigung beziehungsweise Nichtfortführung des Vertragsverhältnisses, sich auf den ausgeschriebenen Auftrag für den Ausführungszeitraum […] zu bewerben. Die insoweit bestehende Unklarheit ist im Rahmen des Nachprüfungsverfahrens geklärt worden. Da die Angebotsfrist von der Antragsgegnerin verlängert wurde, besteht die Möglichkeit für die Antragstellerin sich zu bewerben. Sie ist insoweit nicht mehr beschwert.
c) Unschädlich ist vorliegend, dass sich in der Vergabeakte im Hinblick auf die Festlegung der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” keine ausdrücklichen Ausführungen der Antragsgegnerin im Vorfeld befinden. Die Antragsgegnerin hat die notwendige Dokumentation hier gemäß § 8 VgV nachgeholt.
Der öffentliche Auftraggeber kann im Nachprüfungsverfahren nicht kategorisch mit allen Aspekten und Argumenten präkludiert werden, die nicht im Vergabevermerk niedergelegt worden sind. Vielmehr ist das Nachschieben von Gründen im Rahmen des Beschleunigungsgrundsatzes zuzulassen, wenn keine Anhaltspunkte für eine Manipulation vorliegen und die Transparenz des Vergabeverfahrens gesichert ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. Februar 2020, VII-Verg 2/19; BGH, Beschluss vom 8. Februar 2011, X ZB 4/10). Der Vortrag der Antragsgegnerin enthält hier nachvollziehbare Angaben zu ihren Gründen für die Vermeidung eines Interessenkonflikts nach § 46 Abs. 2 VgV. Anhaltspunkte für eine Manipulation sind nicht ersichtlich. Mit den nachgeholten Ausführungen der Antragsgegnerin zum Vorliegen eines Interessenkonflikts im Rahmen der Rüge und des Nachprüfungsverfahrens ist es der Antragstellerin möglich geworden, die Rechtmäßigkeit der Eignungsanforderungen zu bestreiten und im Nachprüfungsverfahren zu verfolgen. Die Vergabekammer konnte die Gründe der Antragsgegnerin entsprechend überprüfen.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 182 Abs. 1, Abs. 3 S. 1, 5, Abs. 4 S. 1, 2, 4 GWB i.V.m. § 80 Abs. 2, Abs. 3 S. 2 VwVfG.
Eine andere Kostenverteilung zu Lasten der Antragsgegnerin ist aus Billigkeitsgesichtspunkten gemäß § 182 Abs. 3 Satz 5 GWB hier nicht geboten. Das kann zwar unter Umständen der Fall sein, wenn der Auftraggeber dem Begehren des Antragstellers entsprochen hat oder der Antragsgegner durch sei eigenes Verhalten die Antragstellerin erst zu Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens veranlasst hat (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22. Januar 2024, VII-Verg 12/23 in einer Kostenentscheidung zu VK1-101/22). Die Antragstellerin hat jedoch ihr materielles Ziel, eine Änderung der “Eigenerklärung Unabhängigkeit” im Hinblick auf die Zulassung einer parallelen Tätigkeit bei Laufzeitmessungen für den Universaldienstanbieter nicht erreicht und unterliegt damit.
IV.
Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung beginnt, schriftlich beim Oberlandesgericht Düsseldorf – Vergabesenat – einzulegen.
Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.
Die Beschwerde ist bei Gericht als elektronisches Dokument einzureichen. Dieses muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Dies gilt nicht für Anlagen, die vorbereitenden Schriftsätzen beigefügt sind. Ist die Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig.
Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird, und die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt.
Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern.
[…] […]