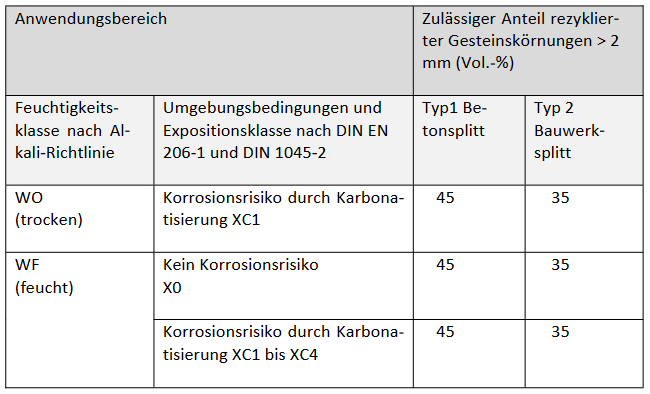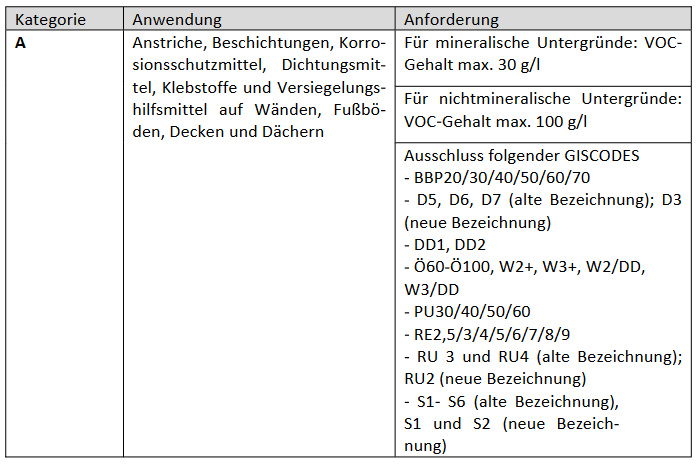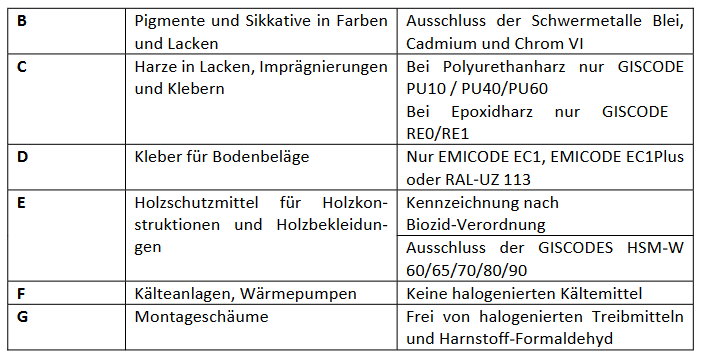Information gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, der Ausrichtung von Wettbewerben sowie der Erfüllung von Verträgen für … (hier jeweils den Namen des Auftraggebers eintragen)
Vorbemerkung:
… führt regelmäßig Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge durch, richtet
Wettbewerbe aus und beauftragt Dritte zur Erfüllung von Verträgen für ….
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
…
2. Beauftragter für den Datenschutz
…
3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten
… erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Durchführung von Vergabeverfahren und bei der Erfüllung von Verträgen.
4. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
Verarbeitende Stellen, auch andere … und externe Stellen, die bei der Durchführung von Vergabeverfahren und bei der Erfüllung von Verträgen beteiligt sind.
5. Dauer der Speicherung
Die erhobenen Daten werden solange aufbewahrt, wie es für die Durchführung der Vergabeverfahren und für die Erfüllung von Verträgen und nachvertragliche Rechtsausübungen notwendig ist und anschließend gelöscht, sofern nicht gesetzliche oder behördliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
6. Betroffenenrechte
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
insbesondere folgende Rechte:
- Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO)
- Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten (Art. 16 DS-GVO)
- Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen von Art. 17
DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in Art. 17 Abs. 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DS-GVO.
- Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden oder bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 litt b, c und d DS-GVO)
- Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.
- Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Art. 21 DS-GVO).
7. Umfang zu übermittelnder Daten
Die Übermittlung personenbezogener Daten, die für das Vergabeverfahren nicht notwendig sind bzw. zu deren Abgabe … Bau nicht aufgefordert hat, ist nicht erforderlich. Es wird vorausgesetzt, dass die datenschutzrechtlichen Erlaubnisse von natürlichen Personen, die in den Angebotsunterlagen genannt werden oder deren Unterlagen (Führungszeugnisse, Sachkundenachweise oder Abschlüsse etc.) vorgelegt werden, vom Bieter eingeholt werden.
8. Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Die Übermittlung personenbezogener Daten für andere als den gesetzlich möglichen Zwecken ist nur zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt hat (Art. 6 Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Einwilligung kann nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit gegenüber der Stelle widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung zuvor erteilt wurde.
9. Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg; Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart; poststelle@lfdi.bwl.de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden.
Artikel 5k der VERORDNUNG (EU) 2022/576 DES RATES vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren
(1) Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:
a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für
a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,
b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,
c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,
d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.
e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder
f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.
(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.
(4) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022— von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.
Stand 01.01.2019
Merkblatt für die Abgabe der Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG)
Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen Erklärung unterstützen.
Allgemeines
Das LTMG verpflichtet öffentliche Auftraggeber, öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen ab einem geschätzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach maßgebliche tarifliche Regelung für die Beschäftigten günstiger ist.
Die Schätzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung (VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer einschließlich etwaiger Prämien oder sonstiger Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung zu entziehen.
Informationen zum LTMG
Beim Regierungspräsidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die über das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen zur Verfügung stellt (https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster für die Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen bekannt. Außerdem fungiert die Servicestelle als Geschäftsstelle des Beirats für die Feststellung der repräsentativen Tarifverträge im Verkehrsbereich.
Zur Verpflichtungserklärung im Einzelnen:
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass meinen / unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unternehmen aufgrund des AEntG gebunden ist;
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage des AEntG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.
In § 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass öffentliche Aufträge über Bau- und Dienstleistungen, die vom AEntG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben werden dürfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschäftigten mindestens das auf der Grundlage des AEntG für allgemeinverbindlich erklärte Entgelt zu zahlen. Das AEntG gilt derzeit für folgende Wirtschaftsbereiche:
– Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektrohandwerk, einschließlich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen außerhalb des Betriebssitzes,
– Gebäudereinigung,
– Briefdienstleistungen,
– Sicherheitsdienstleistungen,
– Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,
– Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft,
– Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst,
– Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch,
– Pflegedienstleistungen
– Schlachten und Fleischverarbeitung.
Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen überwiegend in einer dieser Branchen tätig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschäftigten im jeweiligen Kalenderjahr – bezogen auf die Gesamtarbeitszeit – zeitlich überwiegend die jeweiligen branchentypischen Tätigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausführung der Tätigkeit notwendig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.
Möglich ist auch, dass im Rahmen eines öffentlichen Auftrags nur ein Teil der Beschäftigten des Unternehmens dem AEntG unterfällt. In diesem Fall muss sich das Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschäftigten verpflichten, bei der Ausführung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt (brutto) pro Stunde zu zahlen.
Die Tarifverträge, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, lassen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn- Lohnuntergrenze/branchen-mindestlohn-lohnuntergrenze.html.
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht;
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Bereich des freigestellten Verkehrs gemäß § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst wird;
– dass mein/unser Unternehmen während der Ausführung der Leistung eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachvollzieht.
Öffentlichen Personenverkehrsdienste sind gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 Dienstleistungsaufträge im straßengebundenen öffentlichen Personenverkehr mit Bussen und Straßenbahnen, sonstige Dienstleistungsaufträge im schienengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Bereichen. Dies umfasst sämtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind auch Auftragsvergaben über die nicht als öffentliche Personenverkehre geltenden Verkehrsaufträge im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehören insbesondere der freigestellte Schülerverkehr sowie der Transport von körperlich, geistig oder seelisch behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.
Sind im öffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifverträge einschlägig, müssen Auftragnehmer ihren Beschäftigten zur Erfüllung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt mindestens das in einem der einschlägigen und als repräsentativ festgestellten Tarifverträge vorgesehene Entgelt zahlen.
Die Feststellung der repräsentativen Tarifverträge erfolgt durch das Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Berücksichtigung der Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tätigen Sozialpartnern paritätisch besetzten Beirats.
Die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge werden vom Auftraggeber in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags benannt. Das Verzeichnis der repräsentativen Tarifverträge für öffentliche Aufträge über Verkehrsdienstleistungen nach § 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur Durchführung des § 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht. Zugleich stellt die beim Regierungspräsidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis und die darin enthaltenen Tarifverträge im Internet zur Verfügung (https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch über den QuickLink (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
Grundsätzlich gilt das LTMG auch für den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei öffentlichen Aufträgen über Verkehrsdienstleistungen für den freigestellten Verkehr Tariftreue nach den einschlägigen und repräsentativen Tarifverträgen einzuhalten ist oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hängt von der jeweils ausgeschriebenen Leistung ab. Es gelten die einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwendungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von bis zu neun Personen einschließlich des Fahrzeugführers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des
– 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) betrieben. Derzeit gibt es im Hinblick auf Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf der Straße keine einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge, die die Beförderungen der mit Personenkraftwagen i. S. d. § 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durchgeführten freigestellten Verkehre erfassen. Insofern gilt für die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das Mindestentgelt gem. § 4 LTMG.
Bei Ausschreibungen über die Beförderung von mehr als neun Personen einschließlich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs. 4 Nr. 2 PBefG betrieben. Die Fahrer benötigen eine besondere Qualifikation. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich des einschlägigen und repräsentativen Tarifvertrags („Personenbeförderung durch Kraftomnibusse“).
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht
oder
– dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigen ausgeführt wird. Diese Erklärung ist abzugeben, wenn
– Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschäftigten weniger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen,
– tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Beschäftigten weniger als das aktuell gültige Mindestentgelt bezahlen,
– es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.
Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, müssen sich Unternehmen nach § 4 LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht für die Leistungserbringung durch Auszubildende.
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifischen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird.
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass ich mir/wir uns
– von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder
– von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
§ 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausführung des Auftrags Arbeitskräfte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundsätzlich auch für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom beauftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen kann verzichtet werden, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Hierfür gilt die erste Variante.
Die zweite Variante trägt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13 Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifischen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgeführt wird.
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4
LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklärungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) beträgt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl dafür sorgen, dass Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzahlung einhalten.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,
In § 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nachunternehmen und Verleihunternehmen über die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben, Die öffentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzuführen. Sie haben die Möglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch anlass- oder stichprobenbezogene Prüfungen aufgrund der von den Unternehmen vorzulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen entsprechende vollständige und prüffähige Unterlagen bereitzuhalten.
· dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird, § 8 LTMG regelt die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem Auftragnehmer bei Verstößen.Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen gegen die §§ 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen für ihre Verwirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe beträgt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistungen beträgt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstoß. Die Obergrenze bei mehreren Verstößen beträgt innerhalb eines Auftrags fünf Prozent.
· dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung,
– den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
– mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
Der öffentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihunternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstößen gegen ihre Verpflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben ausschließen. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen im pflichtgemäßen Ermessen des öffentlichen Auftraggebers und haben sich an den Umständen des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Maßnahmen der Unternehmen (z. B. arbeitsrechtliche Maßnahmen) werden angemessen berücksichtigt.
– dass der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben.
Der öffentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kündigen, wenn dies vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 8 Abs. 2 LTMG).
– dass der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert.
Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung bei entsprechenden Verstößen zu informieren.
Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder über den Quick-Link (Der schnelle Klick) „Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
Stand 01.01.2019
Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche
Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG)
1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden;
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollziehen;
(3) für Leistungen,
· deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils geltenden Fassung unterfallen,
· die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbereich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßengebundenen Personenverkehr umfasst werden,
· die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für Behinderte oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unternehmen gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) oder der Auftrag wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitsnehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt;
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung anzuwenden.
2. Nachunternehmen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen,
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen,
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Verpflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen,
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt.
3. Kontrolle
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unternehmen und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Verträge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen einräumen zu lassen,
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vertraglich sicherzustellen.
4. Sanktionen
(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Verstößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von Hundert des Auftragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe beantragen.
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen des LTMG
– kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren Auftragsvergaben ausschließen,
– informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung.
Stand 01.01.2019
Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt (sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene handelt) zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vor-
gaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG)
Ich erkläre/Wir erklären,
· dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht
oder
· mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten ausgeführt wird.
dass ich mir/wir uns
· von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder
· von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versicherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
· dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,
· dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
· dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
– den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
– mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
– der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben.
Stand 01.01.2019
Verpflichtungserklärung
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG)
Ich erkläre/Wir erklären,
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;
– dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.
· dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege;
· sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen.
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuweisen,
· dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten haben,
· dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,
· dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
– den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat,
– mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,
– der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen habe/haben,
– der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung informiert.