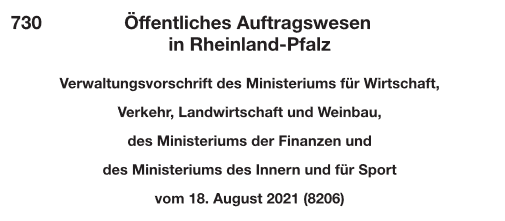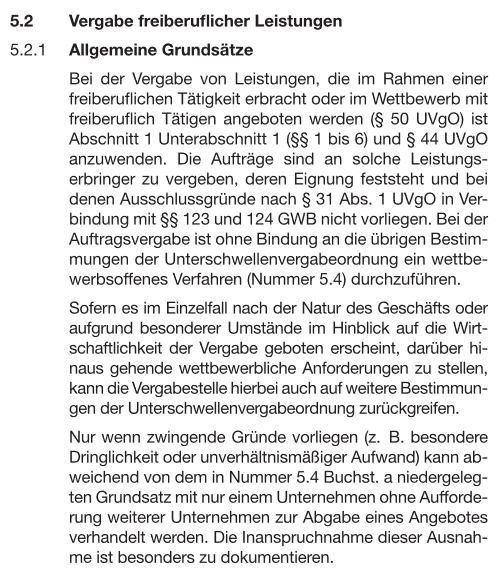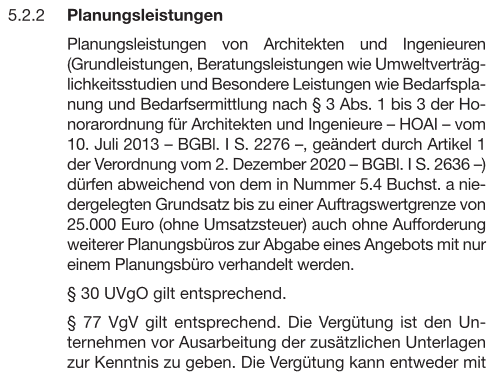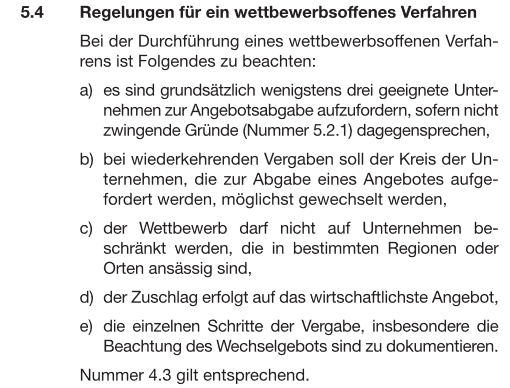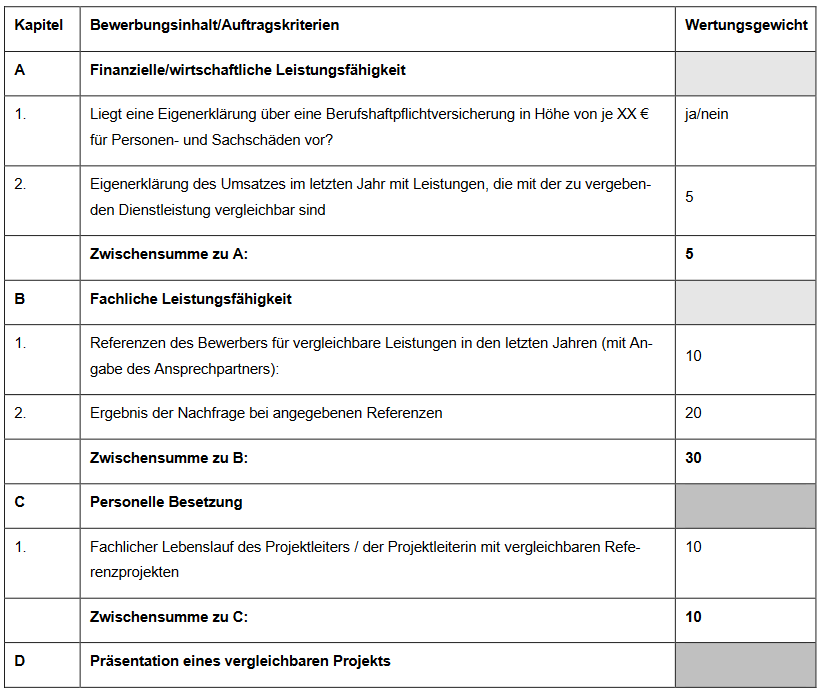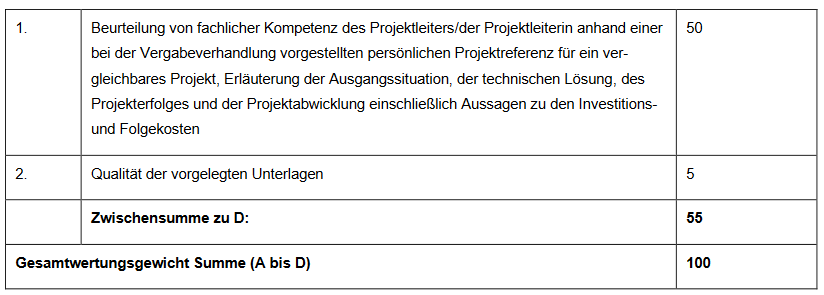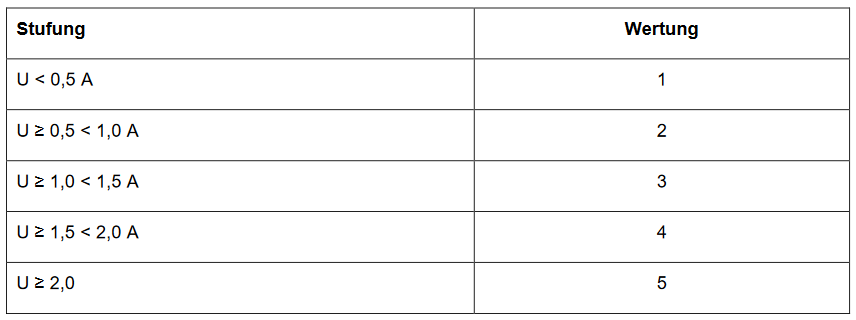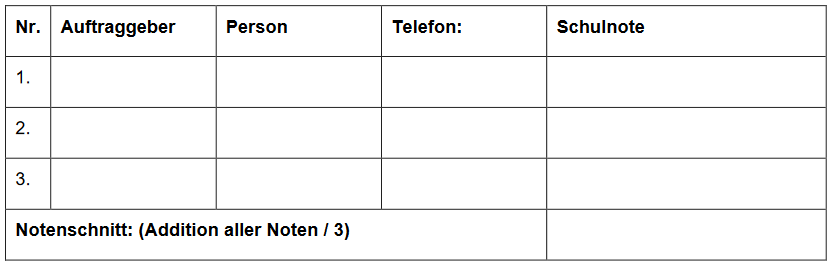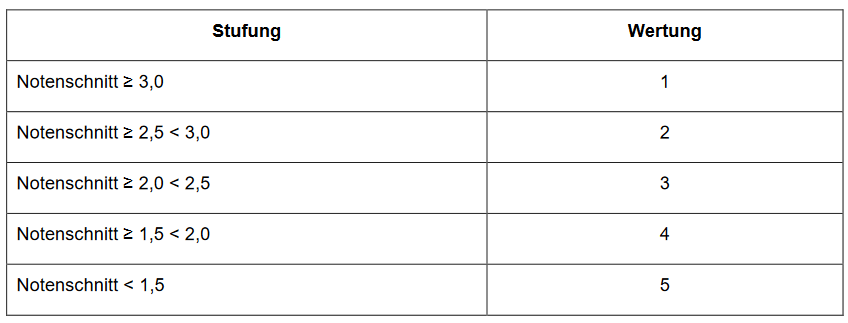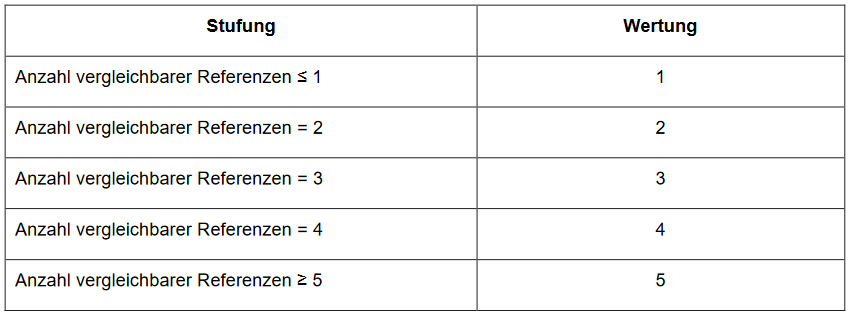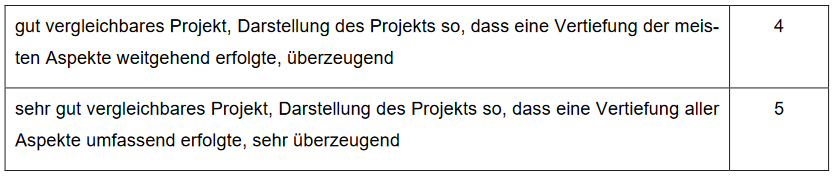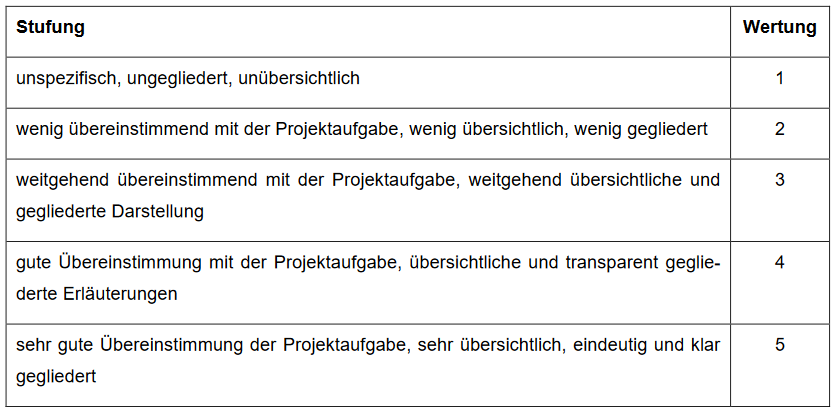Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Bestimmungen
2 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
2.1 Sachlicher Anwendungsbereich
2.1.1 Auftrags- und Vertragswert
2.1.2 Bereichsausnahmen
2.2 Persönlicher Anwendungsbereich
2.2.1 Öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich
2.2.2 Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag eines Dritten
2.2.3 Erweiterungen nach Bundesrecht
2.3 Begriffsbestimmungen
3 Anzuwendende Grundsätze und Vorschriften
3.1 Haushalts- und Vergabegrundsätze
3.2 Anzuwendende Vergabeverfahrensvorschriften
3.3 Binnenmarktrelevanz
3.4 Bestimmungen bei gemeinsamer Auftragsvergabe
3.5 Zusätzliche Bestimmungen für das Vergabeverfahren
3.6 Vergabehandbücher
4 Vergabeverfahrensarten, Auftragswertgrenzen, Direktauftrag
4.1 Vergabeverfahrensarten
4.2 Auftragswertgrenzen
4.3 Direktauftrag
5 Sonderregelungen für bestimmte Vergaben
5.1 Aufträge über preisgebundene Literatur
5.2 Vergabe freiberuflicher Leistungen
5.2.1 Allgemeine Grundsätze
5.2.2 Planungsleistungen
5.2.3 Rahmenvereinbarungen
5.3 Vergabe von Konzessionen im Unterschwellenbereich
5.3.1 Baukonzessionen
5.3.2 Dienstleistungskonzessionen
5.4 Regelungen für ein wettbewerbsoffenes Verfahren
6 Anforderungen an Unternehmen
6.1 Eignung, Zuverlässigkeit und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
6.2 Nachweis der Eignung
6.3 Präqualifizierung
6.4 Scientology-Schutzerklärung
7 Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft
7.1 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
7.2 Vergabeverfahren und Bedingungen
7.2.1 Teilnahme am Wettbewerb
7.2.2 Beteiligung von Bewerber- und Bietergemeinschaften
7.2.3 Teil- und Fachlosvergabe
7.2.4 Zahlung an Nachunternehmen
7.2.5 Kosten und Vergütung
7.2.6 Bindefrist bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen
7.3 General- und Totalübernehmer, General- und Totalunternehmer, Hauptunternehmer, Nachunternehmer
7.3.1 General- und Totalübernehmer
7.3.2 General- und Totalunternehmer
7.3.3 Hauptunternehmer, Nachunternehmer
7.4 Handwerk
7.5 Ergänzende Bestimmungen bei freiberuflichen Leistungen
7.6 Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren durch Dritte
7.7 Einhaltung von Preisvorschriften (Nummer 3.5 Buchst. e)
8 Strategische Beschaffung
8.1 Allgemeine Grundsätze
8.2 Nachhaltige Beschaffung
8.3 Innovative Beschaffung
8.4 Energieeffiziente Beschaffung
8.5 Gütezeichen
9 Berücksichtigung der IAO-Kernarbeitsnormen
9.1 Grundsätze zur Berücksichtigung internationaler Arbeitsstandards
9.2 Nichtberücksichtigung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182
9.2.1 IAO-Übereinkommen Nr. 182
9.2.2 Eigenerklärung
9.3 Berücksichtigung weiterer IAO-Kernarbeitsnormen
9.4 Vergabe durch andere Stellen
10 Barrierefreie Beschaffung, Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Inklusionsbetrieben
10.1 Anforderungen an die Barrierefreiheit
10.2 Vorbehaltene Aufträge
10.3 Bevorzugungsregelung nach dem Sozialgesetzbuch IX
10.3.1 Bevorzugte Unternehmen
10.3.2 Nachweis der Bevorzugteneigenschaft
10.3.3 Inhalt der Bevorzugung
11 Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben
12 Berücksichtigung von Unternehmen mit Frauenfördermaßnahmen
13 Kommunikation (eVergabe)
13.1 Vergabeverfahren mithilfe elektronischer Mittel
13.2 Nutzung des Vergabemarktplatzes (VMP)
14 Vergabedokumentation und Aufbewahrungspflichten
14.1 Mindestanforderungen an die Dokumentation
14.2 Aufbewahrung von Vergabeunterlagen
15 Abfragen aus dem Wettbewerbsregister
15.1 Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters
15.2 Aufgabe des Wettbewerbsregisters
15.3 Abfragepflicht, Abfragemöglichkeit
16 Vergabestatistik im Unterschwellenbereich
16.1 Pflicht zur Vergabestatistik, Berichtsstellen
16.2 Form, Umfang und Frist der Datenübermittlung
17 Beratungsstellen
17.1 Auftragsberatungsstelle
17.2 VOB-Stelle
17.2.1 Sitz und Zusammensetzung
17.2.2 Aufgaben und Befugnisse
17.2.3 Verfahren
18 Nachprüfungsstellen
18.1 Allgemeines
18.2 Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle
18.3 Nachprüfung im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Fachaufsicht
19 Änderungen
20 Inkrafttreten, Übergangsregelungen
Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)
730
Öffentliches Auftragswesen
in Rheinland-Pfalz
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,
des Ministeriums der Finanzen und
des Ministeriums des Innern und für Sport
vom 18. August 2021 (8206)
Fundstelle: MinBl. 2021, S. 91
Inhaltsübersicht
1
Allgemeine Bestimmungen
2
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
2.1
Sachlicher Anwendungsbereich
2.1.1
Auftrags- und Vertragswert
2.1.2
Bereichsausnahmen
2.2
Persönlicher Anwendungsbereich
2.2.1
Öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich
2.2.2
Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag eines Dritten
2.2.3
Erweiterungen nach Bundesrecht
2.3
Begriffsbestimmungen
3
Anzuwendende Grundsätze und Vorschriften
3.1
Haushalts- und Vergabegrundsätze
3.2
Anzuwendende Vergabeverfahrensvorschriften
3.3
Binnenmarktrelevanz
3.4
Bestimmungen bei gemeinsamer Auftragsvergabe
3.5
Zusätzliche Bestimmungen für das Vergabeverfahren
3.6
Vergabehandbücher
4
Vergabeverfahrensarten, Auftragswertgrenzen, Direktauftrag
4.1
Vergabeverfahrensarten
4.2
Auftragswertgrenzen
4.3
Direktauftrag
5
Sonderregelungen für bestimmte Vergaben
5.1
Aufträge über preisgebundene Literatur
5.2
Vergabe freiberuflicher Leistungen
5.2.1
Allgemeine Grundsätze
5.2.2
Planungsleistungen
5.2.3
Rahmenvereinbarungen
5.3
Vergabe von Konzessionen im Unterschwellenbereich
5.3.1
Baukonzessionen
5.3.2
Dienstleistungskonzessionen
5.4
Regelungen für ein wettbewerbsoffenes Verfahren
6
Anforderungen an Unternehmen
6.1
Eignung, Zuverlässigkeit und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
6.2
Nachweis der Eignung
6.3
Präqualifizierung
6.4
Scientology-Schutzerklärung
7
Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft
7.1
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
7.2
Vergabeverfahren und Bedingungen
7.2.1
Teilnahme am Wettbewerb
7.2.2
Beteiligung von Bewerber- und Bietergemeinschaften
7.2.3
Teil- und Fachlosvergabe
7.2.4
Zahlung an Nachunternehmen
7.2.5
Kosten und Vergütung
7.2.6
Bindefrist bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen
7.3
General- und Totalübernehmer, General- und Totalunternehmer, Hauptunternehmer, Nachunternehmer
7.3.1
General- und Totalübernehmer
7.3.2
General- und Totalunternehmer
7.3.3
Hauptunternehmer, Nachunternehmer
7.4
Handwerk
7.5
Ergänzende Bestimmungen bei freiberuflichen Leistungen
7.6
Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren durch Dritte
7.7
Einhaltung von Preisvorschriften (Nummer 3.5 Buchst. e)
8
Strategische Beschaffung
8.1
Allgemeine Grundsätze
8.2
Nachhaltige Beschaffung
8.3
Innovative Beschaffung
8.4
Energieeffiziente Beschaffung
8.5
Gütezeichen
9
Berücksichtigung der IAO-Kernarbeitsnormen
9.1
Grundsätze zur Berücksichtigung internationaler Arbeitsstandards
9.2
Nichtberücksichtigung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182
9.2.1
IAO-Übereinkommen Nr. 182
9.2.2
Eigenerklärung
9.3
Berücksichtigung weiterer IAO-Kernarbeitsnormen
9.4
Vergabe durch andere Stellen
10
Barrierefreie Beschaffung, Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Inklusionsbetrieben
10.1
Anforderungen an die Barrierefreiheit
10.2
Vorbehaltene Aufträge
10.3
Bevorzugungsregelung nach dem Sozialgesetzbuch IX
10.3.1
Bevorzugte Unternehmen
10.3.2
Nachweis der Bevorzugteneigenschaft
10.3.3
Inhalt der Bevorzugung
11
Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben
12
Berücksichtigung von Unternehmen mit Frauenfördermaßnahmen
13
Kommunikation (eVergabe)
13.1
Vergabeverfahren mithilfe elektronischer Mittel
13.2
Nutzung des Vergabemarktplatzes (VMP)
14
Vergabedokumentation und Aufbewahrungspflichten
14.1
Mindestanforderungen an die Dokumentation
14.2
Aufbewahrung von Vergabeunterlagen
15
Abfragen aus dem Wettbewerbsregister
15.1
Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters
15.2
Aufgabe des Wettbewerbsregisters
15.3
Abfragepflicht, Abfragemöglichkeit
16
Vergabestatistik im Unterschwellenbereich
16.1
Pflicht zur Vergabestatistik, Berichtsstellen
16.2
Form, Umfang und Frist der Datenübermittlung
17
Beratungsstellen
17.1
Auftragsberatungsstelle
17.2
VOB-Stelle
17.2.1
Sitz und Zusammensetzung
17.2.2
Aufgaben und Befugnisse
17.2.3
Verfahren
18
Nachprüfungsstellen
18.1
Allgemeines
18.2
Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle
18.3
Nachprüfung im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Fachaufsicht
19
Änderungen
20
Inkrafttreten, Übergangsregelungen
1
Allgemeine Bestimmungen
Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten als:
a)
einheitliche Richtlinie im Sinne des § 55 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2, BS 63-1) in der jeweils geltenden Fassung und
b)
Grundsätze und Richtlinien im Sinne des § 22 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 (GVBl. S. 203, BS 2020-1-2) in der jeweils geltenden Fassung.
Ziel dieser Verwaltungsvorschrift ist es, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen unterhalb der EU-Schwellenwerte von den öffentlichen Auftraggebern zu beachtenden Rechtsvorschriften zusammenzufassen sowie das komplexe Vergaberecht zu strukturieren und transparent zu machen, um damit zur Rechtssicherheit in der Beschaffungspraxis beizutragen.
Zudem dient sie dem von der Landesregierung verfolgten Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der öffentlichen Beschaffung, wie es sich aus den entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes und dem Nachhaltigkeitsbericht der Landesregierung ergibt.
2
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
2.1
Sachlicher Anwendungsbereich
2.1.1
Auftrags- und Vertragswert
Diese Verwaltungsvorschrift gilt für öffentliche Aufträge und Konzessionen, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer die EU-Schwellenwerte (§ 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB – in der Fassung vom 26. Juni 2013 – BGBl. I S. 1750, 3245 – in der jeweils geltenden Fassung) nicht erreichen. Die jeweils gültigen Schwellenwerte werden im Amtsblatt der Europäischen Union und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Höhe des Auftragswertes oder Vertragswertes ermittelt sich nach den Grundsätzen des § 3 der Vergabeverordnung (VgV) vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624) in der jeweils geltenden Fassung beziehungsweise des § 2 der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 683) in der jeweils geltenden Fassung.
2.1.2
Bereichsausnahmen
Diese Verwaltungsvorschrift ist ungeachtet des Erreichens des jeweiligen EU-Schwellenwertes nicht auf Sachverhalte anzuwenden, für die in den §§ 107, 108, 109, 116, 117, 145, 149 oder 150 GWB Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgesehen sind.
2.2
Persönlicher Anwendungsbereich
2.2.1
Öffentliche Auftraggeber im Unterschwellenbereich
Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind:
a)
das Land und die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die § 55 LHO unmittelbar oder nach § 105 LHO zu beachten haben,
b)
die kommunalen Gebietskörperschaften und ihre juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die § 22 GemHVO unmittelbar oder durch Verweisung auf diese Bestimmung zu beachten haben.
2.2.2
Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag eines Dritten
Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten nicht, wenn Behörden des Landes oder der Kommunen Vergabeverfahren im Namen oder im Auftrag des Bundes oder eines anderen Bundeslandes oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union durchführen. Dies ist insbesondere bei Landesbehörden der Fall, die im Wege der Organleihe an den Bund oder sonstige Dritte entliehen sind oder im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung tätig werden. Es gilt das Haushaltsvergaberecht des Entleihers beziehungsweise des Bundes.
2.2.3
Erweiterungen nach Bundesrecht
Die Bestimmungen zum Wettbewerbsregister (Nummer 15) und zur Vergabestatistik (Nummer 16), die jeweils an bundesrechtliche Bestimmungen anknüpfen, welche an öffentliche Auftraggeber nach § 99 GWB gerichtet sind und auch im Unterschwellenbereich Geltung beanspruchen, bleiben unberührt.
2.3
Begriffsbestimmungen
Die in dieser Verwaltungsvorschrift verwendeten Begriffe entsprechen den Definitionen des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der Vergabeverordnung und der Konzessionsvergabeverordnung, soweit in dieser Verwaltungsvorschrift nichts anderes bestimmt wird.
3
Anzuwendende Grundsätze und Vorschriften
3.1
Haushalts- und Vergabegrundsätze
Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sind die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO, § 93 der Gemeindeordnung – GemO – vom 31. Januar 1994 – GVBl. S. 153, BS 2020-1 – in der jeweils geltenden Fassung) zu beachten. Darüber hinaus gelten die Vergaberechtsgrundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit.
Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte werden nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift und der anzuwendenden Verfahrensvorschriften (Nummer 3.2) berücksichtigt.
3.2
Anzuwendende Vergabeverfahrensvorschriften
Für öffentliche Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte gelten § 55 LHO und die Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22, 324; 2017 S. 340) zu § 55 LHO sowie § 22 GemHVO und die Verwaltungsvorschriften zu § 22 GemHVO entsprechend der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV) vom 17. Januar 2017 (MinBl. S. 105) in ihren jeweils geltenden Fassungen. Es sind anzuwenden:
a)
die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1, ber. BAnz AT 08.02.2017 B1) und der Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B) vom 5. August 2003 (BAnz Nummer 178a vom 23.09.2003),
b)
die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) – Ausgabe 2019 – Teil A, Abschnitt 1 vom 19. Februar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2), Teil B vom 7. Januar 2016 (BAnz AT 19.01.2016 B3, ber. BAnz AT 01.04.2016 B1) und Teil C in der Fassung der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), herausgegeben als DIN-Normen, Ausgabe September 2016,
in der jeweils geltenden Fassung, sofern in dieser Verwaltungsvorschrift keine abweichenden oder ergänzenden Regelungen getroffen sind.
Die Vergabe- und Vertragsordnungen stehen im Internet unter www.bmwi.de unter der Rubrik „Öffentliche Aufträge und Vergabe“ und www.fib-bund.de unter der Rubrik „Vergabe“ zur Verfügung.
3.3
Binnenmarktrelevanz
Bei binnenmarktrelevanten öffentlichen Aufträgen und Konzessionen kann sich die Verpflichtung zur Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung aus dem primären Unionsrecht ergeben. In diesen Fällen sind die Auftragsbekanntmachung und die Vergabeunterlagen diskriminierungsfrei auszugestalten, so dass in der Europäischen Union niedergelassene Unternehmen die Möglichkeit haben, ihr Interesse zu bekunden und am Wettbewerb teilzunehmen. Auf die Mitteilung der Kommission vom 1. August 2006 zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (ABl. EU Nr. C 179 S. 2), wird hingewiesen.
3.4
Bestimmungen bei gemeinsamer Auftragsvergabe
Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit öffentlichen Auftraggebern anderer Bundesländer, der Bundesrepublik Deutschland oder von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vergeben werden, soll mit diesen eine Einigung über die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift angestrebt werden. Die Einigung kann sich auch über eine Vielzahl von gemeinsamen Aufträgen erstrecken. Kommt eine Einigung nicht zustande, kann von den Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift abgewichen werden.
Für die Festlegung, welches Vergaberechtsregime der an der gemeinsamen Auftragsvergabe beteiligten öffentlichen Auftraggeber angewendet werden soll, kann auf den höchsten geschätzten Finanzierungsanteil abgestellt werden, der sich für einen der öffentlichen Auftraggeber errechnet.
3.5
Zusätzliche Bestimmungen für das Vergabeverfahren
Auf folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung, die bei der Vergabe öffentlicher Aufträge einschlägig sein können, wird hingewiesen:
a)
Landessicherheitsüberprüfungsgesetz vom 8. März 2000 (GVBl. S. 70, BS 12-3),
b)
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz vom 22. November 2013 (GVBl. S. 459, BS 2129-1),
c)
Mittelstandsförderungsgesetz vom 9. März 2011 (GVBl. S. 66, BS 70-3),
d)
Landestariftreuegesetz (LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 426, BS 70-31); Informationen zum Landestariftreuegesetz erteilt die hierzu beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) eingerichtete Servicestelle in 54292 Trier, Moltkestraße 19, und können unter www.lsjv.rlp.de abgerufen werden,
e)
Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz 1953 Nr. 244 S. 1),
f)
Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123, BS 70-3-1),
g)
Verwaltungsvorschrift „Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung“ vom 22. Januar 2019 (MinBl. S. 14),
h)
Verwaltungsvorschrift „Dienstkraftfahrzeug-Richtlinie (DKfzR)“ vom 17. Dezember 2019 (MinBl. S. 404),
i)
Verwaltungsvorschrift „Richtlinien für Planungswettbewerbe – RPW –“ vom 1. Juni 2014 (MinBl. S. 48; 2019 S. 338).
3.6
Vergabehandbücher
Die mit der Durchführung von Bauaufgaben betrauten Dienststellen werden im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung hingewiesen auf:
a)
das „Vergabe- und Vertragshandbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes“,
b)
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB)“,
c)
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Lieferungen und Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA L-StB)“ sowie
d)
das „Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB)“.
4
Vergabeverfahrensarten, Auftragswertgrenzen, Direktauftrag
4.1
Vergabeverfahrensarten
Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt grundsätzlich nach öffentlicher Ausschreibung oder beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb (§ 55 Abs. 1 LHO, § 22 Abs. 1 GemHVO, § 8 Abs. 2 Satz 1 UVgO, § 3 a Abs. 1 Satz 1 VOB/A). § 8 Abs. 3 und 4 UVgO und § 3 a Abs. 2 und 3 VOB/A bestimmen die Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und die Verhandlungsvergabe oder freihändige Vergabe.
4.2
Auftragswertgrenzen
Bei öffentlichen Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen sind ohne weitere Einzelbegründung zulässig:
a)
Verhandlungsvergaben bis zu 40.000 Euro (§ 8 Abs. 4 Nr. 17 UVgO),
b)
beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb bis zu 80.000 Euro.
Bei öffentlichen Aufträgen über Bauleistungen sind ohne weitere Einzelbegründung zulässig:
a)
freihändige Vergaben bis zu 40.000 Euro (abweichend von § 3 a Abs. 3 Satz 2 VOB/A),
b)
beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb bis zu 200.000 Euro (abweichend von § 3 a Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c VOB/A).
Für die Einhaltung der Auftragswertgrenzen ist der objektiv geschätzte Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens maßgebend. Die Schätzung des Auftragswerts oder Aufteilung des Auftrags in Gewerke/Lose darf nicht in der Absicht erfolgen, die Wertgrenzen zu unterschreiten. Die Auftragswerte beziehen sich auf den im jeweiligen Vergabeverfahren angestrebten zivilrechtlichen Vertrag. Werden z. B. die Bauleistungen für etwa die Herstellung eines beabsichtigten Bauvorhabens in mehreren Losen vergeben, ist – insofern abweichend von § 3 Abs. 7 VgV – der Auftragswert des jeweiligen Loses maßgeblich.
Das für die Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens zuständige Ministerium kann die Auftragswertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen und Verhandlungsvergaben oder freihändige Vergaben befristet erhöhen:
a)
im Rahmen konjunkturfördernder Maßnahmen,
b)
zur Bewältigung von Krisensituationen.
4.3
Direktauftrag
Die Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen ist unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) zulässig. Hierzu empfiehlt sich, eine Markterkundung (z. B. Preisrecherche) durchzuführen.
5
Sonderregelungen für bestimmte Vergaben
5.1
Aufträge über preisgebundene Literatur
Auf die Beschaffung preisgebundener Bücher nach dem Buchpreisbindungsgesetz vom 2. September 2002 (BGBl. I S. 3448), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. November 2020 (BGBl. I S. 2568), finden abweichend von Nummer 3.2 die Verfahrensvorschriften der Unterschwellenvergabeordnung keine Anwendung.
Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen bleiben hiervon unberührt. Nach § 55 Abs. 1 LHO und § 22 Abs. 1 GemHVO muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen beziehungsweise der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Für das Vorliegen dieser Ausnahmesituation bedarf es grundsätzlich einer Prüfung im Einzelfall. Bei der Beschaffung preisgebundener Bücher kann jedoch generell davon ausgegangen werden, dass der Ausnahmetatbestand erfüllt ist.
Diese Aufträge können daher in einem wettbewerbsoffenen Verfahren (Nummer 5.4) an geeignete Unternehmen vergeben werden; in geeigneten Fällen kann das Instrument der Rahmenvereinbarung genutzt werden. Bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) dürfen öffentliche Aufträge über die Beschaffung von preisgebundenen Büchern abweichend von dem in Nummer 5.4 Buchst. a niedergelegten Grundsatz auch ohne Aufforderung von mehreren Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes direkt an ein Unternehmen vergeben werden.
5.2
Vergabe freiberuflicher Leistungen
5.2.1
Allgemeine Grundsätze
Bei der Vergabe von Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden (§ 50 UVgO) ist Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 (§§ 1 bis 6) und § 44 UVgO anzuwenden. Die Aufträge sind an solche Leistungserbringer zu vergeben, deren Eignung feststeht und bei denen Ausschlussgründe nach § 31 Abs. 1 UVgO in Verbindung mit §§ 123 und 124 GWB nicht vorliegen. Bei der Auftragsvergabe ist ohne Bindung an die übrigen Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung ein wettbewerbsoffenes Verfahren (Nummer 5.4) durchzuführen.
Sofern es im Einzelfall nach der Natur des Geschäfts oder aufgrund besonderer Umstände im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabe geboten erscheint, darüber hinaus gehende wettbewerbliche Anforderungen zu stellen, kann die Vergabestelle hierbei auch auf weitere Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung zurückgreifen.
Nur wenn zwingende Gründe vorliegen (z. B. besondere Dringlichkeit oder unverhältnismäßiger Aufwand) kann abweichend von dem in Nummer 5.4 Buchst. a niedergelegten Grundsatz mit nur einem Unternehmen ohne Aufforderung weiterer Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes verhandelt werden. Die Inanspruchnahme dieser Ausnahme ist besonders zu dokumentieren.
5.2.2
Planungsleistungen
Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren (Grundleistungen, Beratungsleistungen wie Umweltverträglichkeitsstudien und Besondere Leistungen wie Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung nach § 3 Abs. 1 bis 3 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI – vom 10. Juli 2013 – BGBl. I S. 2276 –, geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Dezember 2020 – BGBl. I S. 2636 –) dürfen abweichend von dem in Nummer 5.4 Buchst. a niedergelegten Grundsatz bis zu einer Auftragswertgrenze von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) auch ohne Aufforderung weiterer Planungsbüros zur Abgabe eines Angebots mit nur einem Planungsbüro verhandelt werden.
§ 30 UVgO gilt entsprechend.
§ 77 VgV gilt entsprechend. Die Vergütung ist den Unternehmen vor Ausarbeitung der zusätzlichen Unterlagen zur Kenntnis zu geben. Die Vergütung kann entweder mit der Bekanntmachung oder mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgesetzt werden. In solchen Fällen eignet sich auch, ein zweistufiges Verfahren durchzuführen.
5.2.3
Rahmenvereinbarungen
Für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen kann in geeigneten Fällen das Instrument der Rahmenvereinbarung genutzt werden. Die Nummern 5.2.1 und 5.2.2 gelten entsprechend.
5.3
Vergabe von Konzessionen im Unterschwellenbereich
5.3.1
Baukonzessionen
Für die Vergabe von Baukonzessionen unterhalb des EU-Schwellenwertes sind die Bestimmungen über die Vergabe von Bauleistungen sinngemäß anzuwenden (§ 23 VOB/A).
5.3.2
Dienstleistungskonzessionen
Dienstleistungskonzessionen unterhalb des EU-Schwellenwertes sind in einem wettbewerbsoffenen Verfahren (Nummer 5.4) zu vergeben.
5.4
Regelungen für ein wettbewerbsoffenes Verfahren
Bei der Durchführung eines wettbewerbsoffenen Verfahrens ist Folgendes zu beachten:
a)
es sind grundsätzlich wenigstens drei geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern, sofern nicht zwingende Gründe (Nummer 5.2.1) dagegensprechen,
b)
bei wiederkehrenden Vergaben soll der Kreis der Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden, möglichst gewechselt werden,
c)
der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind,
d)
der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot,
e)
die einzelnen Schritte der Vergabe, insbesondere die Beachtung des Wechselgebots sind zu dokumentieren.
Nummer 4.3 gilt entsprechend.
6
Anforderungen an Unternehmen
6.1
Eignung, Zuverlässigkeit und Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
Bieter und Bewerber müssen im Interesse einer sachgerechten Auftragserfüllung nachweisen, dass sie fachkundig und leistungsfähig sind. Bei Bauleistungen ist zudem zu prüfen, ob sie zuverlässig sind, bei Liefer- und Dienstleistungen darf kein Ausschlussgrund im Sinne der §§ 123 oder 124 GWB vorliegen; auf Nummer 15 wird ergänzend hingewiesen.
Ergänzend zu §§ 31 bis 36 UVgO und §§ 6 a und 6 b VOB/A müssen die zur ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrags erforderlichen Anforderungen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, bei den übrigen Vergabearten in den Vergabeunterlagen aufzuführen.
Der öffentliche Auftraggeber kann abweichend von § 6 a Abs. 5 VOB/A auch oberhalb eines Auftragswertes von 10.000 Euro auf Angaben nach § 6 a Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 5 und 6 VOB/A verzichten, wenn dies durch Art und Umfang des Auftrags gerechtfertigt ist.
6.2
Nachweis der Eignung
Als Nachweis der Eignung dürfen nur solche Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) gefordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind und sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben.
Eigenerklärungen sind grundsätzlich ausreichend.
Auf die Vorlage von Einzelnachweisen soll verzichtet werden, soweit die Vergabestelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist.
6.3
Präqualifizierung
Sind zu der Eignung als Auftrag nehmendes Unternehmen Nachweise zu führen und sind diese
a)
in einem anerkannten Register eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten Vertragsstaates oder
b)
in der Liste des anerkannten Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (https://www.pq-verein.de/) oder
c)
im Präqualifikationsregister der Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. (https://www.absthessen.de/hpqr.html) oder
d)
im amtlichen Verzeichnis der Industrie- und Handelskammern (https://amtliches-verzeichnis.ihk.de/)
hinterlegt und nicht älter als 13 Monate, sollen die Vergabestellen diese Bescheinigungen wie individuelle Einzelnachweise zulassen und anerkennen, wenn die geprüften Einzelnachweise nach Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. Der öffentliche Auftraggeber zieht Eintragungen und Angaben in zugelassenen Bescheinigungen nur in begründeten Fällen in Zweifel (Eignungsvermutung).
Das Präqualifikationsverfahren im Liefer- und Dienstleistungsbereich ist dezentral nach Bundesländern organisiert. Die Präqualifizierung nehmen Industrie- und Handelskammern oder die von ihnen getragenen Auftragsberatungsstellen vor (PQ-Stellen). Die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden führt für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ein amtliches Verzeichnis für präqualifizierte Unternehmen nach § 35 Abs. 6 UVgO.
6.4
Scientology-Schutzerklärung
Zur Abwehr von Einflüssen der Organisation „Scientology“ im Bereich des öffentlichen Dienstes ist bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über Beratungs- und Schulungsleistungen die folgende Erklärung zu verlangen:
„Das Beratungs- und Schulungsunternehmen verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Personen nicht die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten. Bei einem Verstoß ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.
Ort, Datum, Unterschrift/Firmenstempel.“
Die Erklärung ist zusammen mit dem Angebot abzugeben, anderenfalls ist das Angebot gegebenenfalls nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 UVgO auszuschließen.
7
Beteiligung der mittelständischen Wirtschaft
Um eine ausgewogene Unternehmensstruktur zu erhalten und zu stärken, eine möglichst breite Streuung mittelstandsgeeigneter öffentlicher Aufträge zu erreichen sowie Wettbewerbsnachteile der mittelständischen Wirtschaft gegenüber großen Unternehmen auszugleichen, ist bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wie folgt zu verfahren:
7.1
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Für die Zuordnung von Unternehmen der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Dienstleistungsgewerbes zu den kleinen und mittleren Unternehmen sind die in der nachfolgenden Tabelle genannten quantitativen Kriterien (KMU-Definition1) zugrunde zu legen.
Kriterium | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 |
| | | | |
Unternehmenstyp | Anzahl Beschäftigte | Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme | Zugehörigkeit zu anderen Unternehmen |
Kleinstunternehmen | < 10 | Umsatz:
≤ 2 Mio. EUR oder Bilanzsumme: ≤ 2 Mio. EUR | Zugehörigkeit zu keiner Gruppe verbundener Unternehmen oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe verbundener Unternehmen, die die Voraussetzungen von 1 und 2 erfüllt. |
Kleine Unternehmen | < 50 | Umsatz:
≤ 10 Mio. EUR oder Bilanzsumme: ≤ 10 Mio. EUR |
Mittlere Unternehmen | < 250 | Umsatz:
≤ 50 Mio. EUR oder Bilanzsumme: ≤ 43 Mio. EUR |
Demnach dürfen die Anzahl der Beschäftigten 249 und der Jahresumsatz 50 Mio. Euro oder die Jahresbilanzsumme 43 Mio. Euro nicht überschreiten. Zudem muss ein Unternehmen von Großunternehmen in dem Sinne unabhängig sein, dass sich weniger als 25 v. H. des Kapitals oder der Stimmanteile im Eigentum eines oder mehrerer Unternehmen befinden, die dieser KMU-Definition nicht entsprechen.
7.2
Vergabeverfahren und Bedingungen
7.2.1
Teilnahme am Wettbewerb
Die Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen am Wettbewerb soll insbesondere dadurch sichergestellt werden, dass der Vergabe regelmäßig eine öffentliche Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgeht (vgl. § 55 Abs. 1 LHO und § 22 Abs. 1 GemHVO).
Bei beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und bei Verhandlungsvergabe oder freihändiger Vergabe sind regelmäßig auch kleine und mittlere Unternehmen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe aufzufordern. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs sollen die Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, möglichst gewechselt werden.
7.2.2
Beteiligung von Bewerber- und Bietergemeinschaften
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich zu einer Bewerber- oder Bietergemeinschaft zusammenzuschließen und ein gemeinsames Angebot abzugeben. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn es den jeweiligen Unternehmen aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, sich als selbstständige Anbieter dem Wettbewerb zu stellen und sie erst durch ein gemeinsames Auftreten zur Teilnahme an der Ausschreibung befähigt werden.
Die Teilnahme von Bewerber- und Bietergemeinschaften an Ausschreibungen ist unter den gleichen Bedingungen wie solche von einzelnen Bewerbern und Bietern zuzulassen. Bestehende Arbeitsgemeinschaften mittelständischer Unternehmen sollen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.
Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben im Teilnahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigte Person für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen.
In die Vergabeunterlagen ist folgende Regelung aufzunehmen:
„In Verträgen zwischen Mitgliedern von Arbeitsgemeinschaften, die sich sowohl aus Unternehmen nach Nummer 7.1 der Verwaltungsvorschrift über das Öffentliche Auftragswesen in Rheinland-Pfalz als auch aus anderen Unternehmen zusammensetzen, dürfen kleine und mittlere Unternehmen nicht benachteiligt werden. Die Verträge sind dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.“
Die Bildung einer Bewerber- und Bietergemeinschaft kann im Einzelfall aus kartellrechtlichen Gründen problematisch sein. So kann eine Bewerber- und Bietergemeinschaft unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, wenn mit ihrer Bildung eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt wird (vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB).
7.2.3
Teil- und Fachlosvergabe
Die Ausschreibungen für Lieferungen und Leistungen sind, soweit es die zu erstellende Lieferung oder Leistung zulässt, durch Bildung von Teil- und Fachlosen so zu gestalten, dass sich kleine und mittlere Unternehmen an der Angebotsabgabe beteiligen können (§ 22 UVgO, § 5 Abs. 2 VOB/A).
Bauleistungen sind grundsätzlich in Lose aufzuteilen und nach Losen zu vergeben (Teillose). Bauleistungen verschiedener Handwerks- oder Gewerbezweige sind in der Regel nach Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt zu vergeben (Fachlose). Die zusammengefasste Vergabe eines öffentlichen Auftrags, der aus mehreren Losen besteht, ist möglich, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern.
Bei der Bestimmung der Losgröße sind die Besonderheiten der jeweiligen Branche, der die Lieferung oder die zu erbringende Leistung überwiegend zuzurechnen ist, zu berücksichtigen. Hierzu stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) auf seiner Internetseite ein Onlineberechnungswerkzeug und einen dazu gehörigen Leitfaden zur Verfügung (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabeverfahren.html).
7.2.4
Zahlung an Nachunternehmen
Unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 6 VOB/B sollen im Interesse kleiner und mittlerer Unternehmen Zahlungen unmittelbar an Nachunternehmen geleistet werden.
7.2.5
Kosten und Vergütung
Für die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten erstattet. Verlangt jedoch der öffentliche Auftraggeber, dass Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen und andere vergleichbare Unterlagen ausarbeiten, insbesondere in den Fällen der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm und der funktionalen Leistungsbeschreibung, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen.
7.2.6
Bindefrist bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen
Bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen über Bauleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen soll eine längere Bindefrist als 50 Kalendertage nur in begründeten Fällen festgesetzt werden.
7.3
General- und Totalübernehmer, General- und Totalunternehmer, Hauptunternehmer, Nachunternehmer
7.3.1
General- und Totalübernehmer
Die Vergabe von Bauleistungen an General- und Totalübernehmer ist nicht zulässig.
Generalübernehmer sind solche Unternehmen, die mehrere oder alle Bauleistungen übernehmen, selbst aber keine Bauleistung gewerbsmäßig erbringen. Totalübernehmer übernehmen neben den Bauleistungen auch Planungsleistungen, ohne selbst diese Leistungen zu erbringen.
Baubetreuungsunternehmen dürfen mit der Planung, Koordinierung und Finanzierung nur beauftragt werden, wenn
a)
baufachliche, technische, personelle oder organisatorische Gründe dies erfordern,
b)
dem öffentlichen Auftraggeber alle wichtigen Entscheidungen, insbesondere über Planungs- und Vergabeangelegenheiten (z. B. Wahl des Vergabeverfahrens, Auswahl der Bewerber oder Bieter, Zuschlagserteilung), vorbehalten bleiben und
c)
das Unternehmen verpflichtet wird, die für den öffentlichen Auftraggeber geltenden Vorschriften zu beachten.
7.3.2
General- und Totalunternehmer
Die Auftragsvergabe an General- und Totalunternehmer ist nur zulässig, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe eine Gesamtlosvergabe erfordern. Dies ist durch den öffentlichen Auftraggeber im Rahmen einer einzelfallbezogenen Interessenabwägung festzustellen und entsprechend zu dokumentieren.
Generalunternehmer sind solche Hauptauftragnehmer, die sämtliche für die Herstellung eines Bauwerks erforderlichen Bauleistungen zu erbringen haben und wesentliche Teile hiervon selbst ausführen. Totalunternehmer übernehmen neben den Bauleistungen auch Planungsleistungen.
Ein General- und Totalunternehmer, der keinen wesentlichen Teil der Bauleistung selbst erbringt, steht dem General- und Totalübernehmer gleich (vgl. Nummer 7.3.1).
7.3.3
Hauptunternehmer, Nachunternehmer
Im Falle der Weitervergabe von Aufträgen an Nachunternehmer ist in den Vergabeunterlagen stets vorzusehen, dass der Auftragnehmer (Hauptunternehmer)
a)
bei der Einholung von Angeboten für Nachunternehmeraufträge nach wettbewerblichen Gesichtspunkten verfährt und dabei kleinere und mittlere Unternehmen nicht benachteiligt,
b)
rechtzeitig vor der Übertragung Namen und Anschriften der Nachunternehmer sowie deren Berufsgenossenschaften mitzuteilen hat,
c)
nur solche Nachunternehmer beauftragen darf, die die gewerbe- und handwerksrechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung des zu vergebenden Unterauftrages erfüllen,
d)
den Nachunternehmer davon in Kenntnis setzt, dass seine Leistung der Erfüllung eines öffentlichen Auftrages dient und
e)
auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers die Einhaltung vorstehender Verpflichtungen sowie Art und Umfang der zur Weitervergabe vorgesehenen Leistungen nachzuweisen hat.
7.4
Handwerk
Da handwerkliche Leistungen auch in Ausführung öffentlicher Aufträge nur von Auftragnehmern erbracht werden dürfen, die in die Handwerksrolle oder in das Verzeichnis der Inhaber eines Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes eingetragen sind, ist in Zweifelsfällen die Vorlage der Handwerkskarte zu verlangen oder die Eintragung bei der zuständigen Handwerkskammer abzufragen. Unberührt hiervon bleibt die Beteiligung von Unternehmen, die bei der Industrie- und Handelskammer registriert sind, ferner von Neben- und Hilfsbetrieben im Sinne der Handwerksordnung sowie von ausländischen Betrieben, die in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes eingetragen sind.
7.5
Ergänzende Bestimmungen bei freiberuflichen Leistungen
Den kleinen und mittleren Unternehmen gleichgestellt sind die freiberuflich Tätigen, deren Jahresumsatz einen Betrag von 2,5 Mio. Euro nicht übersteigt. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über freiberufliche Leistungen ist zu beachten, dass
a)
sich Angehörige dieser Berufe nur unter Einhaltung ihrer Berufsordnungen und gesetzlichen Honorarordnungen um Aufträge bewerben dürfen,
b)
kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger angemessen beteiligt werden.
Es ist besonders zu berücksichtigen, dass die Vergabe von Leistungen, die eine technische, gutachterliche, künstlerische oder gestalterische Ausführung erfordern, auch nach dem Gesichtspunkt eines Leistungswettbewerbs erfolgt.
7.6
Vorbereitung und Abwicklung von Vergabeverfahren durch Dritte
Die Nummern 7.1 bis 7.5 sind von den öffentlichen Auftraggebern auch dann anzuwenden, wenn diese Dritte mit der Vorbereitung und Abwicklung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen – bei Bauvorhaben z. B. freiberufliche Architekten oder Ingenieure, Sonderfachleute, Baubetreuungsunternehmen usw. – beauftragen. Dies ist durch vertragliche Vereinbarungen mit den beauftragten Dritten sicherzustellen.
7.7
Einhaltung von Preisvorschriften (Nummer 3.5 Buchst. e)
Bei Aufträgen, die ohne Ausschreibung vergeben werden sollen oder bei denen sich auf eine Ausschreibung nur ein Unternehmen gemeldet hat, kann die für den Auftragnehmer zuständige Preisüberwachungsstelle eingeschaltet werden.
8
Strategische Beschaffung
8.1
Allgemeine Grundsätze
In Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlichen Aufgabe, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, müssen das Land und seine Untergliederungen im Rahmen von Beschaffungen und der Vergabe öffentlicher Aufträge mit gutem Beispiel vorangehen und eine Vorbildfunktion übernehmen. Das Vergaberecht bietet verschiedene Anknüpfungspunkte zur Berücksichtigung strategischer Aspekte im Rahmen des Beschaffungsprozesses, die sich gegenseitig ergänzen können.
Die öffentlichen Auftraggeber legen im Rahmen ihres Leistungsbestimmungsrechts fest, welche Produkte und Leistungen sie beschaffen möchten. Dies schließt die Bestimmung der Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie der Auftragsdurchführung grundsätzlich mit ein.
In allen Phasen einer Beschaffung, von der Definition der Leistung über die Festlegung von Eignungs- und Zuschlagskriterien bis hin zur Vorgabe von Ausführungsbedingungen können qualitative, soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte einbezogen werden.
Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung können sich die öffentlichen Auftraggeber auch auf den Prozess oder die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind. Solche Merkmale müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und zu dessen Wert und den Beschaffungszielen verhältnismäßig sein.
8.2
Nachhaltige Beschaffung
Die „Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung“ beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (KNB) ist das zentrale Portal für öffentliche Auftraggeber für die Berücksichtigung von Kriterien der Nachhaltigkeit bei ihren Beschaffungsvorhaben (https://www.nachhaltigebeschaffung.info/DE). Es unterstützt die Vergabestellen des Bundes, der Länder und Kommunen beim Informationsaustausch und stellt Informationen und konkrete Handlungshilfen sowie Beratungen über E-Mail, Telefonhotline oder auch vor Ort zur Verfügung.
Umfangreiche Informationen zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung in allen Phasen eines Vergabeverfahrens bietet auch das Webportal „Kompass Nachhaltigkeit“ (https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/), das im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und in Kooperation mit der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung aufgebaut wurde.
8.3
Innovative Beschaffung
Für innovative Beschaffungen betreibt das BMWi gemeinsam mit dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. das Kompetenzzentrum Innovative Beschaffung (https://www.koinno-bmwi.de/koinno/). Es ist die Anlaufstelle bei allen Fragen rund um das Thema innovative öffentliche Beschaffung und unterstützt öffentliche Auftraggeber durch Informationsmaterial, Praxisbeispiele, Veranstaltungen sowie kostenfreie Einzelfallberatungen bei der Ausrichtung innovationsorientierter Beschaffungsprozesse.
8.4
Energieeffiziente Beschaffung
Zur angemessenen Berücksichtigung von Aspekten des Umwelt- und des Klimaschutzes können sich die öffentlichen Auftraggeber im Hinblick auf die Energieeffizienz an der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Leistungen (AVV-EnEff) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 18. Mai 2020 (BAnz AT 26.05.2020 B1) in der jeweils geltenden Fassung orientieren.
8.5
Gütezeichen
Ein besonders wirksames Mittel für eine strategische Beschaffung kann die Nutzung von Gütezeichen sein. Der öffentliche Auftraggeber kann als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten in der Leistungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, die Vorlage von Gütezeichen, Zertifikaten oder Siegeln nach Maßgabe des § 24 UVgO oder § 7 a Abs. 5 VOB/A verlangen. Über Inhalt, Anforderungen und Bedeutung solcher Nachweise informiert die Internetplattform „Kompass Nachhaltigkeit“ (https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/guetezeichen/).
9
Berücksichtigung der IAO-Kernarbeitsnormen
9.1
Grundsätze zur Berücksichtigung internationaler Arbeitsstandards
Eine verantwortliche Vergabe schließt die Berücksichtigung der sozialen Bedingungen der Menschen, die an der Herstellung des Auftragsgegenstandes beteiligt sind, ein. Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen ist darauf hinzuwirken, dass keine Leistungen Gegenstand des Auftrags sind, die unter Missachtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) festgelegten Mindeststandards gewonnen oder hergestellt worden sind. Dies gilt insbesondere, sofern eine oder mehrere der folgenden Warengruppen und Artikel Gegenstand der Leistung ist oder sind, falls diese in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt oder bearbeitet wurden:
1.
Textilwaren, insbesondere Bekleidung, Sportbekleidung, Stoffe, Wäsche, Bettwaren einschließlich Matratzen, Handtücher und Gardinen,
2.
Naturstein, soweit nicht die Verwendung gebrauchter Materialien beabsichtigt ist,
3.
Agrarerzeugnisse, insbesondere Tee, Kaffee, Kakaoprodukte einschließlich Schokolade, Rohrzucker, Früchte sowie daraus hergestellte Säfte und andere Erzeugnisse, Gewürze, Öle, Nüsse und Reis,
4.
Schnittblumen,
5.
Spielwaren und Sportbälle,
6.
Holzwaren,
7.
Lederwaren und Gerbprodukte.
Zu den international anerkannten Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation zählen die folgenden acht Übereinkommen:
a)
Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II S. 640, 641),
b)
Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2072, 2073),
c)
Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1122, 1123),
d)
Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBl. 1956 II S. 23, 24),
e)
Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl. 1959 II S. 441, 442),
f)
Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 1958 (BGBl. 1961 II S. 97, 98),
g)
Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 201, 202),
h)
Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291).
Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit als vordringlicher Aufgabe der Mitgliedstaaten der IAO zu legen (Nummer 9.2).
Im Rahmen der geltenden Vergaberechtsordnung können Anforderungen, die dem Schutz von in die Lieferkette eingebundenen Beschäftigten auch im Ausland dienen, durch eine geeignete Bestimmung des Leistungsgegenstandes oder die Aufnahme zusätzlicher Bedingungen an die Auftragsdurchführung gestellt werden. Zu praktischen Hilfestellungen und Beratung für eine nachhaltige Beschaffung wird auf Nummer 8.2 und 8.5 hingewiesen.
9.2
Nichtberücksichtigung von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182
9.2.1
IAO-Übereinkommen Nr. 182
Das Übereinkommen Nr. 182 der IAO vom 17. Juni 1999 verpflichtet jeden Mitgliedstaat, der dieses Übereinkommen ratifiziert hat, unverzügliche und wirksame Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die schlimmsten Formen der Kinderarbeit vordringlich verboten und beseitigt werden. Es ist für die Bundesrepublik Deutschland am 18. April 2003 in Kraft getreten (Bek. vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) und wird auf nationaler Ebene durch entsprechende Vorschriften zum Jugendarbeitsschutz vollzogen.
Der öffentliche Auftraggeber achtet darüber hinaus bei seiner Beschaffung darauf, dass bei der Herstellung oder Bearbeitung der entsprechenden Produkte weder gegen die nationalen Jugendarbeitsschutzgesetze verstoßen wird noch gegen Normen, die außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes zur Umsetzung des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erlassen wurden oder die sonst dem Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit dienen (vgl. § 2 a LTTG).
9.2.2
Eigenerklärung
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist in begründeten Fällen eine Eigenerklärung zu verlangen, dass bei der Ausführung des Auftrags nur Produkte Berücksichtigung finden, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182 über die schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt oder bearbeitet wurden, beziehungsweise die Zusicherung, dass das Unternehmen, seine Lieferanten und deren Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen eingeleitet haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei der Herstellung oder Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen. Der öffentliche Auftraggeber kann in der Leistungsbeschreibung entsprechende Gütezeichen (vgl. Nummer 8.5) vorgeben. Im Übrigen ist das in der Anlage beigefügte Muster zu verwenden.
Die Erklärung wird bei Annahme des Angebots Vertragsbestandteil. Eigenerklärungen kommen derzeit insbesondere bei den unter Nummer 9.1 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Warengruppen und Artikeln in Betracht.
Die Nichtabgabe der Erklärung oder die Abgabe einer wissentlich oder vorwerfbar falschen Erklärung hat den Ausschluss von dem laufenden Vergabeverfahren zur Folge.
Erweist sich nach Vertragsschluss, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Erklärung abgegeben oder gegen mit der Erklärung eingegangene Verpflichtungen verstoßen wurde, so sollen Verträge nach VOL/B oder VOB/B in der Regel aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
9.3
Berücksichtigung weiterer IAO-Kernarbeitsnormen
In geeigneten Fällen sind bei der Vergabe auch die sich aus den weiteren Kernarbeitsnormen ergebenden sozialen Anforderungen im Rahmen der Lieferkette zu beachten. Eine entsprechende Prüfung ist insbesondere bei den unter Nummer 9.1 Abs. 1 Satz 3 genannten Warengruppen und Artikeln veranlasst.
Die im jeweiligen Fall gestellten Anforderungen müssen den Auftragsgegenstand betreffen oder mit ihm in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Ihre Erfüllung darf für die Bewerber oder Bieter nicht unverhältnismäßig oder unzumutbar sein. Sie müssen in der Leistungsbeschreibung hinreichend klar gefasst sein (Bestimmtheit) und mit Anforderungen verbunden werden, die eine effektive Nachprüfung der Richtigkeit der in den Angeboten enthaltenen Angaben erlauben (Prüfbarkeit).
9.4
Vergabe durch andere Stellen
Den kommunalen und den landeseigenen Unternehmen in privater Rechtsform sowie den Unternehmen mit Landesbeteiligung wird empfohlen, entsprechend den vorstehenden Regelungen zu verfahren.
10
Barrierefreie Beschaffung, Berücksichtigung von Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten und Inklusionsbetrieben
10.1
Anforderungen an die Barrierefreiheit
Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind die Anforderungen der Barrierefreiheit nach dem Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen vom 16. Dezember 2002 (GVBI. S. 481, BS 87-1) in der jeweils geltenden Fassung im Rahmen verfügbarer Mittel, wo immer dies sinnvoll ist, zu berücksichtigen. Die auf die jeweilige Vergabe anzupassenden technischen Spezifikationen sind klar festzulegen, sodass alle Bewerber oder Bieter wissen, was die Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers umfassen.
Praktische Hilfestellungen und Formulierungshilfen für die Leistungsbeschreibung sind im Internet unter www.barrierefrei.rlp.de abrufbar.
10.2
Vorbehaltene Aufträge
Öffentliche Auftraggeber können die Teilnahme an Vergabeverfahren Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Unternehmen vorbehalten, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist (Sozialunternehmen), oder bestimmen, dass öffentliche Aufträge im Rahmen von Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen durchzuführen sind. Voraussetzung ist, dass mindestens 30 v. H. der in diesen Werkstätten oder Unternehmen Beschäftigten Menschen mit Behinderungen oder benachteiligte Personen sind (vgl. auch § 118 GWB, § 1 Abs. 3 UVgO).
Die Ausschreibung kann ausschließlich auf anerkannte Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Blindenwerkstätten oder Sozialunternehmen beschränkt werden. Zu den Sozialunternehmen zählen auch Inklusionsbetriebe nach § 215 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) in der jeweils geltenden Fassung. Bei öffentlichen Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte ist eine Verhandlungsvergabe (§ 8 Abs. 4 Nr. 16 Buchst. a UVgO) oder eine freihändige Vergabe (§ 3 Nr. 3 VOB/A) zulässig.
10.3
Bevorzugungsregelung nach dem Sozialgesetzbuch IX
10.3.1
Bevorzugte Unternehmen
Öffentliche Aufträge, die von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 219 Abs. 1 SGB IX) oder Blindenwerkstätten ausgeführt werden können, werden bevorzugt diesen Werkstätten angeboten (§§ 224 und 226 SGB IX). Diese Bestimmung ist auch auf Inklusionsbetriebe im Sinne des § 215 SGB IX anzuwenden (§ 224 Abs. 2 SGB IX). Gleiches gilt für Einrichtungen anderer Staaten, die mit den vorgenannten deutschen Einrichtungen vergleichbar sind.
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten bis zum Inkrafttreten einer späteren Regelung durch allgemeine Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung, die mit Zustimmung des Bundesrates erlassen werden (§ 224 Abs. 1 Satz 2 SGB IX).
10.3.2
Nachweis der Bevorzugteneigenschaft
Zum Nachweis der Bevorzugteneigenschaft ist den Vergabestellen auf Verlangen vorzulegen
a)
bei Werkstätten für behinderte Menschen die von der Bundesagentur für Arbeit nach § 225 SGB IX ausgesprochene Anerkennung und ein Auszug aus dem Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und deren Leistungsangebot, das bei der Bundesagentur für Arbeit geführt wird; dabei genügen die bestehenden Anerkennungen im Sinne der §§ 5 und 13 des durch Artikel 30 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) mit Wirkung vom 14. September 2007 außer Kraft getretenen Blindenwarenvertriebsgesetzes vom 9. April 1965 (BGBl. I S. 311), weiterhin als Nachweis.
b)
bei Inklusionsbetrieben eine Bescheinigung des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz über die Anerkennung als Inklusionsbetrieb im Sinne des § 215 SGB IX.
Der Nachweis der Bevorzugteneigenschaft kann für Werkstätten für behinderte Menschen, Blindenwerkstätten, Inklusionsbetriebe und vergleichbare Einrichtungen in anderen Staaten durch eine entsprechende Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder Herkunftslands dieser Einrichtung erbracht werden.
Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt, so kann sie durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Einrichtung vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befugten Behörde des betreffenden Staates abgibt. In den Staaten, in denen es eine derartige eidesstattliche Erklärung nicht gibt, kann dies durch eine feierliche Erklärung ersetzt werden. Die Echtheit der eidesstattlichen oder feierlichen Erklärung ist durch die zuständige Behörde oder den Notar zu bescheinigen.
Der Nachweis soll nicht älter als ein Jahr sein.
Die Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz (Nummer 17.1) kann den Vergabestellen bevorzugte Unternehmen benennen. Sie ist verpflichtet, auch Einrichtungen in anderen Staaten zu benennen, die ihr bekannt sind und die die Voraussetzungen dieser Nummer erfüllen.
Im Internet ist ein Verzeichnis
a)
der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen unter www.arbeitsagentur.de und www.rehadat-wfbm.de
b)
der anerkannten Inklusionsbetriebe, insbesondere in Rheinland-Pfalz, unter www.rehadat-adressen.de
abrufbar. Die kostenfreie Datenbank REHADAT (www.rehadat.de) enthält umfangreiche Informationen zur beruflichen Rehabilitation und Eingliederung behinderter Menschen, unter anderem über das Leistungsangebot der Werkstätten für behinderte Menschen und der Inklusionsbetriebe.
10.3.3
Inhalt der Bevorzugung
Bei beschränkten Ausschreibungen und Verhandlungsvergaben oder freihändigen Vergaben sind regelmäßig auch die bevorzugten Unternehmen in angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe mit aufzufordern.
Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie das ansonsten wirtschaftlichste Angebot eines nicht bevorzugten Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen.
Bei der Wertung der Angebote ist der von bevorzugten Unternehmen angebotene und zur Wertung herangezogene Preis
a)
bei anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und anerkannten Blindenwerkstätten mit einem Abschlag von 15 v. H.,
b)
bei anerkannten Inklusionsbetrieben mit einem Abschlag von 10 v. H.
zu berücksichtigen.
Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, ist nur der Anteil zu berücksichtigen, den die bevorzugten Einrichtungen an dem Gesamtangebot der Arbeitsgemeinschaft haben. Die Vergabestellen haben in den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, dass bei der Angebotsabgabe der Anteil der bevorzugten Einrichtungen anzugeben ist.
In jedem Fall, in dem dies nach Art und Menge der geforderten Leistung zweckmäßig ist, soll der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt werden, damit sich auch kleine beziehungsweise mehrere der genannten Einrichtungen um diese Aufträge bemühen und von den Aufträgen profitieren können. Unwirtschaftliche Zersplitterungen sind zu vermeiden.
11
Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben
Bei der Wertung der Angebote ist im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen bei sonst wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten dem Unternehmen bevorzugt der Zuschlag zu erteilen, das zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Verhältnis zu den mitbietenden Unternehmen Ausbildungsplätze bereitstellt oder sich an der beruflichen Erstausbildung beteiligt.
Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind auf gesondertes Verlangen des öffentlichen Auftraggebers durch eine Eigenerklärung nachzuweisen. Eine Anwendung dieser Regelung ist ausgeschlossen, wenn eines der gleichwertigen Angebote von einem ausländischen Bieter abgegeben wurde. Die Nummern 10.2 und 10.3 bleiben unberührt. Der öffentliche Auftraggeber hat hierauf in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen hinzuweisen.
12
Berücksichtigung von Unternehmen mit Frauenfördermaßnahmen
Bei der Wertung der Angebote ist im Rahmen der vergaberechtlichen Bestimmungen bei sonst wirtschaftlich gleichwertigen Angeboten dem Unternehmen bevorzugt der Zuschlag zu erteilen, das zum Zeitpunkt der Ausschreibung im Verhältnis zu den mitbietenden Unternehmen umfassendere Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben durchführt.
Nummer 11 Abs. 2 gilt entsprechend.
13
Kommunikation (eVergabe)
13.1
Vergabeverfahren mithilfe elektronischer Mittel
Für die Kommunikation zwischen öffentlichem Auftraggeber und Bietern oder Bewerbern in einem Vergabeverfahren gelten die einschlägigen Vergabeverfahrensordnungen. Es wird empfohlen, alle Vergabeverfahren grundsätzlich mithilfe elektronischer Mittel durchzuführen.
Vergabeverfahren über Liefer- und Dienstleistungsaufträge mit einem geschätzten Auftragswert bis 20.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) können bis zum 31. Mai 2022 auch mittels einfacher E-Mail durchgeführt werden. § 7 Abs. 4, § 39 Satz 1 und § 40 UVgO gelten insoweit nicht.
Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können (§ 29 Abs. 1 UVgO; § 11 Abs. 3 VOB/A). Interessenten müssen die Vergabeunterlagen direkt ohne Registrierung herunterladen können. Eine freiwillige Registrierung ist möglich und zu empfehlen, damit interessierte Unternehmen über ergänzende Bieterinformationen unterrichtet werden können. Ohne Registrierung müssen die Unternehmen selbst bemüht sein, solche Informationen in Erfahrung zu bringen (Holschuld).
13.2
Nutzung des Vergabemarktplatzes (VMP)
Die Vergabestellen der unmittelbaren Landesverwaltung und der landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne der Nummer 2.2.1 Buchst. a nutzen für die elektronische Durchführung öffentlicher Beschaffungen die Vergabeplattform des Landes Rheinland-Pfalz als Vergabemarktplatz (VMP). Das den vorgenannten Nutzern des VMP optional zur Verfügung stehende Vergabemanagementsystem (VMS) unterstützt die digitale rechtskonforme Abwicklung des gesamten internen arbeitsteiligen Vergabeprozesses.
14
Vergabedokumentation und Aufbewahrungspflichten
14.1
Mindestanforderungen an die Dokumentation
Das Vergabeverfahren ist nach § 6 UVgO beziehungsweise § 20 VOB/A von Beginn an fortlaufend in Textform zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten werden.
14.2
Aufbewahrung von Vergabeunterlagen
Die Vergabeunterlagen (Dokumentation, Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen) sind für mindestens fünf Jahre nach Vorlage der Schlussrechnung aufzubewahren. Sonstige, z. B. zuwendungsrechtliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
15
Abfragen aus dem Wettbewerbsregister
15.1
Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters
Mit dem Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb eines Registers zum Schutz des Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregistergesetz – WRegG) vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Januar 2021 (BGBl. I S. 2) wurde die Rechtsgrundlage für ein bundeseinheitliches Wettbewerbsregister geschaffen. Das Wettbewerbsregister wird beim Bundeskartellamt in Form einer elektronischen Datenbank geführt (§ 1 Abs. 1 und 3 WRegG). Einzelheiten des Melde- und Abfrageverfahrens sind in der Wettbewerbsregisterverordnung (WRegV) vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 809) geregelt.
Das BMWi hat das Vorliegen der Voraussetzungen für die elektronische Datenübermittlung festzustellen und im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Meldepflichten durch die Strafverfolgungsbehörden und der Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufen sind, werden nach Ablauf des Monats, der auf den Tag der Bekanntmachung durch das BMWi folgt, wirksam. Die Abfragepflichten der Auftraggeber beginnen sechs Monate nach Ablauf des Monats der Bekanntmachung (§ 12 WRegG).
Sobald das Wettbewerbsregister nach § 6 WRegG verpflichtend abzufragen ist, wird hierdurch die bisher bestehende Pflicht des öffentlichen Auftraggebers zur Abfrage beim Gewerbezentralregister bei öffentlichen Aufträgen mit einem Wert von mehr als 30.000 Euro nach § 21 Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 448), nach § 19 Abs. 3 des Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1657), und nach § 21 Abs. 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1657), ersetzt. Gleiches gilt für die Abfragepflicht nach Nummer 4.3.5 Abs. 8 der Verwaltungsvorschrift „Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung“. Für die Dauer von drei Jahren nach Inbetriebnahme des Wettbewerbsregisters bleibt den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit erhalten, ergänzend auch das Gewerbezentralregister abzufragen.
15.2
Aufgabe des Wettbewerbsregisters
Mit dem Wettbewerbsregister werden den öffentlichen Auftraggebern Informationen über Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123 und 124 GWB zur Verfügung gestellt. Die eintragungspflichtigen Rechtsverstöße sind in § 2 WRegG abschließend aufgezählt. Die Entscheidung über die Eintragung trifft die Registerbehörde auf der Grundlage der meldepflichtigen Informationen, die ihr von den Strafverfolgungsbehörden und der zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden übermittelt werden. Eine Eintragung im Register wird entweder nach Ablauf der Eintragungsfrist (§ 7 WRegG) oder vorzeitig nach einer erfolgreichen Selbstreinigung des Unternehmens (§ 8 WRegG) wieder gelöscht. Die grundsätzlichen Anforderungen an eine Selbstreinigung ergeben sich aus § 8 Abs. 1 WRegG in Verbindung mit § 123 Abs. 4 Satz 2 und § 125 Abs. 1 GWB. Nach § 6 Abs. 5 WRegG entscheidet der öffentliche Auftraggeber in eigener Verantwortung über den Ausschluss eines Unternehmens von einem Vergabeverfahren nach den §§ 123 bis 125 GWB. Eine Registereintragung hat daher nicht automatisch einen Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge.
15.3
Abfragepflicht, Abfragemöglichkeit
Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB sind verpflichtet, vor Erteilung des Zuschlags in einem Vergabeverfahren mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) das Wettbewerbsregister zu demjenigen Bieter, an den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben beabsichtigt, abzufragen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 WRegG). Damit besteht grundsätzlich die Abfragepflicht oberhalb und unterhalb der EU-Schwellenwerte. Registerabfragen können nur von öffentlichen Auftraggebern und nur im Rahmen von konkreten Vergabeverfahren vorgenommen werden.
Bei Bietergemeinschaften betrifft die Abfragepflicht alle an der Bietergemeinschaft beteiligten Unternehmen.
Eine Verpflichtung zur Abfrage besteht nicht bei Sachverhalten, für die das Vergaberecht Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Vergaberechts vorsieht (§ 6 Abs. 1 Satz 3 WRegG). Auf eine erneute Anfrage zu konkreten Unternehmen kann verzichtet werden, wenn innerhalb der letzten zwei Monate zu dem Unternehmen bereits eine Auskunft aus dem Wettbewerbsregister erteilt wurde (§ 6 Abs. 1 Satz 5 WRegG).
Neben der Abfragepflicht besteht für öffentliche Auftraggeber und Konzessionsgeber im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift die Möglichkeit, vor der Vergabe eines öffentlichen Auftrags oder einer Konzession auch unterhalb der jeweiligen Wertgrenzen das Wettbewerbsregister abzufragen (§ 6 Abs. 2 WRegG).
16
Vergabestatistik im Unterschwellenbereich
16.1
Pflicht zur Vergabestatistik, Berichtsstellen
Nach § 2 Abs. 2 der Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 691), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2020 (BGBl. I S. 674), sind alle öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur Übermittlung von Informationen über vergebene Aufträge an das Statistische Bundesamt verpflichtet, wenn
a)
der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25.000 Euro überschreitet (Bagatellgrenze),
b)
der Auftragswert den geltenden EU-Schwellenwert nach § 106 GWB unterschreitet,
c)
die Vergabe des öffentlichen Auftrags nach den jeweils maßgeblichen Vorgaben des Bundes oder der Länder vergabe- und haushaltsrechtlichen Verfahrensregeln unterliegt und
d)
der Auftrag im Übrigen unter die Regelungen des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fallen würde.
Zur Erfüllung seiner Statistikpflicht bestimmt der Auftraggeber eine Berichtsstelle. Er kann sich auch mehrerer Berichtsstellen bedienen. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die statistische Daten zu vergebenen öffentlichen Aufträgen melden, die sie als Vergabe- oder Beschaffungsstelle selbst oder die sie im Auftrag anderer Auftraggeber vergeben haben (§ 1 Abs. 1 Satz 3 VergStatVO). Eine Berichtsstelle muss sich vorab beim Statistischen Bundesamt registrieren.
16.2
Form, Umfang und Frist der Datenübermittlung
Die Datenübermittlung im Unterschwellenbereich erfolgt über ein elektronisches Verfahren. Dieses ermöglicht den Auftraggebern sowohl automatisiert per Datenschnittstelle aus einem IT-System beziehungsweise Fachverfahren (z. B. Vergabeplattformen auf Landes- oder Kommunalebene) als auch manuell über ein Online-Formular die Übermittlung der Informationen über vergebene Aufträge an das Statistische Bundesamt.
Die Daten, die von der Berichtsstelle eines Auftraggebers nach Zuschlagserteilung im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Auftrags im Unterschwellenbereich dem Statistischen Bundesamt zu melden sind, ergeben sich aus Anlage 8 (zu § 3 Abs. 2) VergStatVO. Zu dem Merkmal „Nachhaltigkeitskriterien“ der Merkmalgruppe „Angaben zum Verfahren“ wird auf die nicht abschließenden Erläuterungen der Anlage 9 VergStatVO hingewiesen. Öffentliche Auftraggeber können auch bei Unterschwellenvergaben freiwillig weitere Daten an das Statistische Bundesamt übermitteln (§ 3 Abs. 3 VergStatVO).
Die Daten sind innerhalb von 60 Tagen nach Zuschlagserteilung an das Statistische Bundesamt zu übermitteln (§ 1 Abs. 2 VergStatVO).
17
Beratungsstellen
17.1
Auftragsberatungsstelle
Als Ansprechpartner für alle Vergabestellen des Bundes, der Länder und der Kommunen haben die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz mit Unterstützung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums die Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz eingerichtet.
Aufgabe der Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz ist es, rheinland-pfälzische Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung
a)
über das öffentliche Auftragswesen zu informieren und zu beraten,
b)
bei der Akquisition öffentlicher Aufträge zu unterstützen und
c)
auf Antrag für eine mögliche Beteiligung an beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben oder freihändigen Vergaben der öffentlichen Hand zu registrieren.
Auf Anforderung von öffentlichen Auftraggebern benennt die Auftragsberatungsstelle bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben oder freihändigen Vergaben ab Auftragswerten über 5.000 Euro fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen.
Die Funktion der Auftragsberatungsstelle Rheinland-Pfalz wird wahrgenommen vom:
IHK/Hwk-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz
Herzogenbuscher Straße 14
54292 Trier
Telefon: 0651/97567-16
Internet: https://www.abc-rlp.de
E-Mail: info@abc-rlp.de
17.2
VOB-Stelle
17.2.1
Sitz und Zusammensetzung
Bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist eine VOB-Stelle eingerichtet, bestehend aus einer Geschäftsstelle und einem Ausschuss besonders erfahrener Personen aus dem Bereich des Bauvergaberechts (VOB-Ausschuss). Grundlage ist die im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und den Ministerien ergangene Anordnung des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 16. September 1978 (StAnz. S. 643) in der jeweils geltenden Fassung.
Die Anschrift der VOB-Stelle lautet:
VOB-Stelle für Rheinland-Pfalz
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Hohenfelder Straße 16
56068 Koblenz
Telefon: 0261/500818-3551 oder 3552
E-Mail: VOB-Stelle@add.rlp.de
17.2.2
Aufgaben und Befugnisse
Die VOB-Stelle soll bei öffentlichen oder mit öffentlichen Mitteln geförderten Bauvorhaben
a)
allgemein darauf hinwirken, dass die Ausschreibungen und Vergaben den Bestimmungen des Bauvergaberechts entsprechen,
b)
Mitteilungen über unzulässige Abweichungen von den Bestimmungen des Bauvergaberechts nachgehen und für eine möglichst rasche Klärung sorgen,
c)
Stellungnahmen abgeben, die sich auf die Prüfung und Feststellung unzulässiger Abweichungen von den Bestimmungen des Bauvergaberechts beschränken.
Die VOB-Stelle hat gegenüber den Vergabestellen oder Aufsichtsbehörden keine Weisungsbefugnisse. Ihre Einschaltung hat keine Aussetzung des Vergabeverfahrens zur Folge.
17.2.3
Verfahren
Die VOB-Stelle wird auf Antrag tätig. Die Geschäftsstelle klärt den Sachverhalt unverzüglich auf. Liegt ihr eine Angabe vor, die einen Verstoß gegen das Bauvergaberecht vermuten lässt, unterrichtet die Geschäftsstelle hiervon die ausschreibende Stelle mit der Empfehlung, vor der Zuschlagserteilung die abschließende Stellungnahme der VOB-Stelle abzuwarten. Die Aufsichtsbehörde ist gleichzeitig zu unterrichten. In einfachen Fällen soll die Geschäftsstelle gewünschte Auskünfte unverzüglich erteilen.
Bei eindeutigen Verstößen gegen die Bestimmungen des Bauvergaberechts weist die Geschäftsstelle die ausschreibende Stelle unverzüglich auf den Verstoß hin. In schwierigen Fällen beruft die Geschäftsstelle den VOB-Ausschuss zur Beratung ein. Die Geschäftsstelle leitet ihre Stellungnahme oder die Stellungnahme des VOB-Ausschusses dem Betroffenen, der ausschreibenden Stelle und deren Aufsichtsbehörde zu.
Wird das Bauvorhaben aus öffentlichen Mitteln gefördert, übersendet die Geschäftsstelle in diesen Fällen die Stellungnahme auch der zuständigen Bewilligungsbehörde. Die Aufsichtsbehörde und die Bewilligungsbehörde unterrichten die VOB-Geschäftsstelle über die von ihnen getroffenen Maßnahmen.
Die Verbände und Selbstverwaltungsorganisationen der gewerblichen Wirtschaft sollen auf eine so rechtzeitige Einschaltung der VOB-Stelle hinwirken, dass unterschiedliche Auffassungen über die Sach- und Rechtslage noch vor der Zuschlagserteilung ausgeräumt werden können.
Das Recht der Betroffenen, sich unmittelbar an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden oder ein Nachprüfungsverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. Die Befassung der VOB-Stelle ist ausgeschlossen, sobald ein Vergabeverfahren zur Nachprüfung bei der Vergabeprüfstelle nach der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen anhängig ist.
18
Nachprüfungsstellen
18.1
Allgemeines
Für die Überprüfung von Vergabeverfahren ab Erreichen der EU-Schwellenwerte können die Vergabekammern angerufen werden. Das Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer bestimmt sich nach Teil 4 Kapitel 2 (§§ 155 ff.) des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen; ergänzend wird auf §§ 134 und 135 GWB sowie auf die Landesverordnung über die Nachprüfungsbehörden für die Vergabe öffentlicher Aufträge und von Konzessionen vom 19. Januar 1999 (GVBl. S. 18, BS 70-30) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen. Weitere Hinweise zum Verfahren sind dem Internetauftritt der Vergabekammer für Rheinland-Pfalz unter https://mwvlw.rlp.de/de/ministerium/zugeordnete-institutionen/vergabekammer/ zu entnehmen.
Das Vergaberecht im Unterschwellenbereich ist Teil des Haushaltsrechts und damit dem Verwaltungsinnenrecht zuzuordnen. Bietern und Bewerbern ist – anders als im Oberschwellenbereich (§ 97 Abs. 6 GWB) – kein subjektiv einklagbares Recht eingeräumt. Dennoch gibt es seit dem 1. Juni 2021 erstmals im Unterschwellenbereich eine strukturierte rechtsaufsichtliche Prüfung von Vergabeverfahren. So können mögliche Rechtsverstöße bei wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen vor die Vergabeprüfstelle gebracht werden.
18.2
Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle
Die Nachprüfung von wirtschaftlich bedeutsamen öffentlichen Aufträgen obliegt der landesweit zuständigen Vergabeprüfstelle bei dem für die Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens zuständigen Ministerium.
Die Kontaktdaten der Vergabeprüfstelle lauten:
Vergabeprüfstelle beim
Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftstraße 9
55116 Mainz
E-Mail: vergabepruefstelle@mwvlw.rlp.de
Einzelheiten, insbesondere zu den Voraussetzungen, der Einleitung einer strukturierten Nachprüfung und der Entscheidung der Vergabeprüfstelle sowie zu den Kosten einer Nachprüfung ergeben sich aus § 7 a des Mittelstandsförderungsgesetzes in Verbindung mit der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen.
18.3
Nachprüfung im Rahmen der allgemeinen Rechts- und Fachaufsicht
Vergabeverfahren unterliegen grundsätzlich der Rechts- und Fachaufsicht, unabhängig von einer strukturierten Nachprüfung durch die Vergabeprüfstelle. Spezifische Vorgaben zur Rechts- und Fachaufsicht ergeben sich aus § 3 der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen.
19
Änderungen
Die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“ vom 24. April 2014 (MinBl. S. 48; 2020 S. 222) wird wie folgt geändert:
In der Überschrift werden die Worte „Auftrags- und“ gestrichen.
Nummer 1 Abs. 1, die Nummern 2 bis 11.4, Nummer 21, 22.1, 23 und 25 sowie die Anlage werden gestrichen.
Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorgenannten Änderungen angepasst.
20
Inkrafttreten, Übergangsregelungen
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Ausnahme von Nummer 5.1 am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
Nummer 5.1 tritt am 1. August 2022 in Kraft; für die Beschaffung preisgebundener Bücher ist bis 31. Juli 2022 weiter nach Nummer 2.2 Abs. 3 der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz“ vom 24. April 2014 (MinBl. S. 48; 2020 S. 222) zu verfahren.
Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift begonnen wurden, sind nach den bisher geltenden Bestimmungen zu beenden.
Anlage: Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit