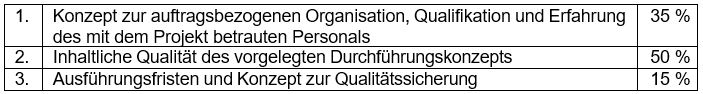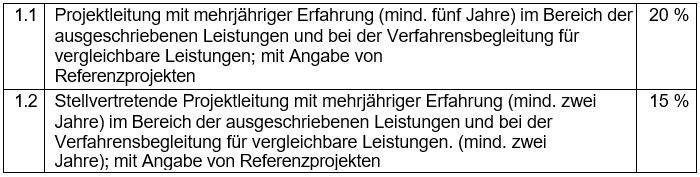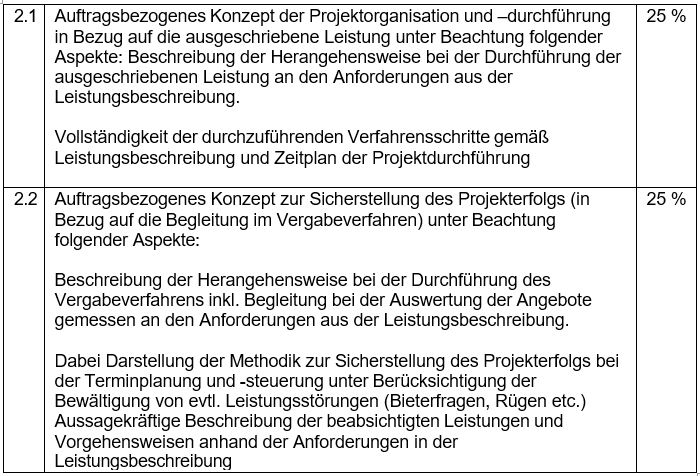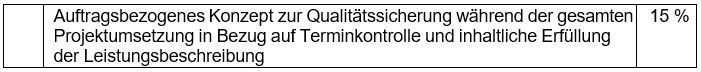Die Vergabestelle folgt bezogen auf die jeweilige Vergabeverfahrensart deren jeweiligen
prozessualen Ablauf:
• Offenes Verfahren (Teil 1)
• Nicht offenes Verfahren (Teil 2)
• Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ((Teil 3)
• Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (Teil 4)
Die Vergabestelle folgt dabei dem folgenden grundsätzlichen Aufbau:
• Einleitungsphase
• gegebenenfalls Bewerbungsphase (bei Vergabeverfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb)
• gegebenenfalls Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge (bei Vergabeverfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb)
• Angebotsphase
• Prüfung und Wertung der Angebote und gegebenenfalls (bei Vergabeverfahrensarten mit Verhandlungen) Verhandlungen
• Zuschlagsphase
Teil 3
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
3. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
3.1.1. Bekanntmachung
Nachdem Planung und Design des Verhandlungsverfahrens abgeschlossen und die Vergabeunterlagen fertiggestellt sind, erfolgt die Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens beziehungsweise des damit verbundenen Teilnahmewettbewerbes. Die Auftragsbekanntmachung beziehungsweise die Veröffentlichung der Bekanntmachung europaweiter Vergabeverfahren ist in §§ 37, 40 VgV geregelt. Darin teilen öffentliche Auftraggeber ihre Absicht, einen Auftrag zu vergeben beziehungsweise eine Rahmenvereinbarung abzuschließen in einer Auftragsbekanntmachung mit. Die Auftragsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt. Es ist darauf zu achten, dass die Auftragsbekanntmachung alle vorgeschriebenen Inhalte umfasst. So regelt beispielsweise § 122 Abs. 4 GWB, dass Eignungskriterien in der Auftragsbekanntmachung aufzuführen sind. Bekanntmachungen müssen dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch übermittelt werden. Der Tag der Absendung muss durch den öffentlichen Auftraggeber nachgewiesen werden können. Zur Erstellung und Übermittlung der Bekanntmachung kann ein elektronisches Formular auf der Internetseite der Europäischen Union „eNotices-Formulare für das öffentliche Auftragswesen“ genutzt werden. Für den Zugang zu eNotices muss einmalig ein Benutzerkonto eingerichtet werden. Die Zugangsrechte müssen behördenintern organisatorisch geregelt werden. Das Auftragsbekanntmachungsformular ist vereinheitlicht und gilt für alle EU-weiten Vergabe- und Verfahrensarten für Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen. Innerhalb dieses Formulars ist die jeweils zu vergebende Lieferung und / oder Leistung einer standardisierten Nummer zuzuordnen – der sogenannten CPV-Nummer. Der Katalog des Common Procurement Vocabulary (CPV) dient dem Zweck, dass bei europaweiten Vergabeverfahren die zu vergebende Leistung in allen EU-Staaten gleichermaßen beschrieben und verständlich ist. Bekanntmachungen europaweiter Verfahren dürfen auch auf nationaler Ebene (beispielsweise auf www.bund.de oder diversen länderspezifischen Vergabeplattformen) veröffentlicht werden.
3.1.2. Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Die Bereitstellung der Vergabeunterlagen europaweiter Vergabeverfahren ist in § 41 VgV geregelt. Die Vergabeunterlagen müssen vom Bieter über eine elektronische Adresse unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können. Das heißt der öffentliche Auftraggeber hat die Unterlagen auf einer Webseite (zum Beispiel dem Webauftritt des Auftraggebers oder einer Vergabeplattform) – ohne Registrierungs- und Anmeldezwang – zum direkten Download bereitzustellen. Bewerber beziehungsweise Bieter dürfen nicht dazu aufgefordert werden, die Vergabeunterlagen per Mail beim Auftraggeber abzurufen.
Die elektronische Adresse (Internetadresse) zum Abruf der Vergabeunterlagen ist in der EU-Bekanntmachung anzugeben. Ausnahme bilden die in § 41 Abs. 2 VgV geregelten technischen Gründe, wenn zum Beispiel Dateiformate zur Beschreibung der Leistung beziehungsweise der Angebote zum Einsatz kommen, die nicht mit allgemein verfügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können. Die Angebotsfrist ist in diesem Fall um fünf Tage zu verlängern, sofern nicht ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit (gemäß § 17 Abs. 8 VgV) besteht. Auch erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und ein damit verbundener abweichender Zugang zu den Vergabeunterlagen bilden (gemäß § 41 Abs. 3 VgV) Ausnahmen und erfordern – sofern es sich nicht ausschließlich um die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung handelt oder der oben genannten Dringlichkeit besteht – eine Angebotsfristverlängerung.
Wird anlässlich eines Interessensbekundungsverfahrens mittels vorab durchgeführter Vorinformation auf die Auftragsbekanntmachung verzichtet, so wird die elektronische Adresse zum Abruf der Vergabeunterlagen nur denjenigen Bietern, verbunden mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung und Abgabe eines Teilnahmeantrages sowie weiteren Informationen gemäß § 52 Abs. 3 VgV, mitgeteilt (beispielsweise per Mail), die bis zum Ablauf der Interessensbekundungsfrist ihr Interesse bekundet haben.
3.2. Bewerbungsphase
3.2.1. Behandlung der Bewerberfragen
Innerhalb der Teilnahmeantragsfrist können die Bewerber zusätzliche sachdienliche Auskünfte erbitten. Diese Auskünfte sind unverzüglich zu erteilen und sollten im Verhandlungsverfahren bei rechtzeitiger Anforderung durch die Bewerber – orientiert an den Fristen für die Angebotsphase – spätestens sechs Tage (beziehungsweise vier Tage bei aufgrund von Dringlichkeit beschleunigten Verfahren) vor Ablauf der Teilnahmeantragsfrist erteilt werden, andernfalls sollte die Teilnahmeantragsfrist verlängert werden. Nach dem Gebot der Gleichbehandlung haben alle Bewerber Anspruch auf die gleichen Informationen. Dies lässt sich nachvollziehbar dokumentieren, indem alle Anfragen (gemäß den Grundsätzen der Kommunikation nach §§ 9 ff. VgV) mit elektronischen Mitteln (in Textform) gestellt und allen Bewerbern gleichzeitig mit elektronischen Mitteln (in Textform) – beispielsweise über eine entsprechende E-Vergabeplattform – beantwortet werden. Die Kommunikation kann in Ausnahmefällen auch mündlich erfolgen, sofern sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigung oder die Angebote betreffen, beispielsweise bei technischen Fragen zur verwendeten E-Vergabeplattform. In der Praxis werden mitunter Fristvorgaben gemacht, bis zu welchem Termin Bewerberfragen zugelassen und als rechtzeitig betrachtet werden. Die VgV sieht eine solche Fristsetzung aber nicht vor. Zwar ist das Setzen einer Frist für Bewerberfragen möglich und zur Organisation des Vergabeverfahrens sinnvoll. Die Vergabestelle muss aber berücksichtigen, dass erkannte Defizite oder Fehler in jedem Stand des Vergabeverfahrens zu korrigieren sind, so dass die Vergabestelle gegebenenfalls Klarstellungen für alle interessierten Unternehmen herbeiführen muss, und zwar völlig unabhängig davon, ob eine Frist für Bewerberfragen bereits abgelaufen ist oder wie kurzfristig die Frage vor dem Ablauf der Teilnahmeantragsfrist eingeht. Mit der gegebenenfalls verspäteten
Beantwortung einer solchen Frage ist dann die Teilnahmeantragsfrist ebenfalls zu verlängern.
3.2.2. Behandlung und Öffnung der Teilnahmeanträge
Elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge (sowie gegebenenfalls im Rahmen eines Interessensbekundungsverfahrens eingeholte Interessensbekundungen beziehungsweise Interessensbestätigungen) sind nach § 54 VgV auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Eingesetzte E-Vergabesysteme oder -Plattformen bieten in der Regel entsprechende Funktionalitäten. Im Übrigen gilt, dass die Vergabestelle beim Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel zu verwenden hat, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Teilnahmeanträge sind mit einem Eingangsvermerk auf dem ungeöffneten Umschlag zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Fax übermittelte Teilnahmeanträge sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. Bevor die Vergabestelle eine nicht-elektronische Einreichung vorsieht, hat er zu prüfen, ob eine solche Einreichungsform (noch) rechtlich zulässig ist. Die Vergabestelle darf nach § 55 VgV vom Inhalt der Teilnahmeanträge erst nach Ablauf der Angebotsfrist Kenntnis nehmen. Die Öffnung der Teilnahmeanträge ist von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist durchzuführen.
Die Öffnung der Teilnahmeanträge ist in Textform zu dokumentieren. Die Teilnahmeanträge sind nach der Öffnung vertraulich aufzubewahren.
3.3. Prüfung und Wertung Teilnahmeanträge
3.3.1. Prüfung der Teilnahmeanträge / Eignungsprüfung
Im Anschluss an die Öffnung der Teilnahmeanträge hat die Vergabestelle diese gemäß den vergaberechtlichen Vorschriften und insbesondere unter Berücksichtigung der in den Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben und Anforderungen der Eignungsprüfung zugrunde zu legen.
Im Rahmen der Eignungsprüfung prüft die Vergabestelle zunächst das Vorliegen von Ausschlussgründen nach den §§ 123, 124 GWB und, ob und inwieweit die am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen fachkundig und leistungsfähig (geeignet) sind. Die Ausschlussgründe in diesem Sinne sind teilweise zwingend (ohne Ermessen für den Auftraggeber, § 123 GWB), teilweise fakultativ (Kann-Ausschluss mit Ermessensentscheidung für den Auftraggeber,
§ 124 GWB). Hier hat die Vergabestelle den entsprechenden Katalog der Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB sowie die Regelungen zur Selbstreinigung (§§ 125, 126 GWB) zu beachten. Im Übrigen sind für die Eignungsprüfung die dahingehenden Vorgaben, namentlich die Festlegungen zu den Eignungskriterien, in den Vergabeunterlagen und der Auftragsbekanntmachung (gegebenenfalls in einer Eignungsbewertungsmatrix) maßgeblich. Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Planung und eines ordnungsgemäßen Designs der Beschaffung hat der Auftraggeber entsprechende Eignungskriterien festgelegt und definiert, die ausschließlich Folgendes betreffen:
• Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
• wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
• technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Die Vergabestelle darf von den Bietern Aufklärung über deren Eignung verlangen.
3.3.2. Auswahl der Bewerber
Die Vergabestelle wählt die Bewerber zur Abgabe eines Angebotes aus, bei denen keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und die die Eignungskriterien (am besten) erfüllen. Die Vorgaben für die Auswahlentscheidung (zum Beispiel Eignungsbewertungsmatrix und Mindest- / Höchstzahl der auszuwählenden Bewerber) hat die Vergabestelle bereits in der Planung und im Design einer Beschaffung rechtmäßig in den Vergabeunterlagen festgelegt und definiert. Für die Auswahl der am besten geeigneten Bewerber erfolgt demgemäß nach einer Bewertung des Auftraggebers auf der Grundlage einer Eignungsbewertungsmatrix, ob und inwieweit der Bewerber die in den Vergabeunterlagen durch Eignungskriterien und gegebenenfalls Eignungsbewertungsmatrix vorgegebenen Eignungsanforderungen erfüllt.
Die Vergabestelle ist dabei gehalten, die und nur die Eignungskriterien und gegebenenfalls Eignungsbewertungsmatrix anzuwenden, die er im Rahmen der Planung und Designs einer Beschaffung, in der Auftragsbekanntmachung und in den Vergabeunterlagen, rechtmäßig festgelegt und definiert hat. Die Vergabestelle darf keine Unterkriterien, Gewichtungsregeln, Punkte- oder sonstige Bewertungssysteme anwenden, die er den am Auftrag interessierten Unternehmen nicht in der Auftragsbekanntmachung zur Kenntnis gebracht hat. Eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung der Eignungskriterien und gegebenenfalls Eignungsbewertungsmatrix ist grundsätzlich unzulässig. Die Vergabestelle hat die Bewerber, die nicht ausgewählt werden und damit im Teilnahmewettbewerb ausscheiden, über die Gründe für die Ablehnung ihres Teilnahmeantrages zu unterrichten (§ 62 Abs. 2 VgV, § 134 Abs. 1 S. 2 GWB). Sämtliche Entscheidungen, einschließlich der zugehörigen Begründungen im Rahmen der Eignungsprüfung (insbesondere auch über die Ergebnisse der Prüfung auf Ausschlussgründe, einschließlich etwaiger Begründungen für Ermessensentscheidungen, und über das Ergebnis der Bewertung unter den einzelnen B-Kriterien, einschließlich deren Begründung) sind in der Vergabeakte zu dokumentieren.
3.4. Angebotsphase
3.4.1. Aufforderung zur Angebotsabgabe
Nur die vom Auftraggeber im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Unternehmen werden vom Auftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe enthält regelmäßig die Bezeichnung des Vergabeverfahrens, das Aktenzeichen und möglicherweise ein Begleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen. Weiterhin sollte der Aufbau der Vergabeunterlagen in einer Übersicht dargestellt werden und die Angebotsfrist sowie die Stelle, bei der das Angebot oder die angeforderten Unterlagen einzureichen sind, benannt werden. Beim Verhandlungsverfahren ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe auch der konkrete weitere Verfahrensablauf vom Auftraggeber anzugeben. Das konkrete Vorgehen des Auftraggebers im Verhandlungsverfahren bestimmt sich dann nach den vom Auftraggeber aufgestellten Vorgaben zum Verfahrensablauf.
3.4.2. Behandlung der Bieterfragen
Innerhalb der Angebotsfrist können die Bieter zusätzliche sachdienliche Auskünfte erbitten. Diese Auskünfte sind unverzüglich zu erteilen und müssen im Verhandlungsverfahren bei rechtzeitiger Anforderung durch die Bieter spätestens sechs Tage (beziehungsweise vier Tage bei aufgrund von Dringlichkeit beschleunigten Verfahren) vor Ablauf der Angebotsfrist erteilt werden, andernfalls ist die Angebotsfrist zu verlängern. Nach dem Gebot der Gleichbehandlung haben alle Bieter Anspruch auf die gleichen Informationen. Dies lässt sich nachvollziehbar dokumentieren, indem alle Anfragen (gemäß den Grundsätzen der Kommunikation nach §§ 9 ff. VgV) mit elektronischen Mitteln (in Textform) gestellt und allen Bietern gleichzeitig mit elektronischen Mitteln (in Textform) – beispielsweise per Mail oder über eine entsprechende E-Vergabeplattform – beantwortet werden. Die Kommunikation kann in Ausnahmefällen auch mündlich erfolgen, sofern sie nicht die Vergabeunterlagen oder die Angebote betreffen, beispielsweise bei technischen Fragen zur verwendeten E-Vergabeplattform.
In der Praxis werden mitunter Fristvorgaben gemacht, bis zu welchem Termin Bieterfragen zugelassen und als rechtzeitig betrachtet werden. Die VgV sieht eine solche Fristsetzung aber nicht vor. Zwar ist das Setzen einer Frist für Bieterfragen möglich und zur Organisation des Vergabeverfahrens sinnvoll. Die Vergabestelle muss aber berücksichtigen, dass erkannte Defizite oder Fehler in jedem Stand des Vergabeverfahrens zu korrigieren sind, so dass die Vergabestelle gegebenenfalls Klarstellungen für alle interessierten Unternehmen herbeiführen muss, und zwar völlig unabhängig davon, ob eine Frist für Bieterfragen bereits abgelaufen ist oder wie kurzfristig die Frage vor dem Ablauf der Angebotsfrist eingeht. Mit der gegebenenfalls verspäteten Beantwortung einer solchen Frage ist dann die Angebotsfrist ebenfalls zu verlängern.
3.4.3. Behandlung und Öffnung der Erstangebote
Elektronisch übermittelte Angebote sind nach § 54 VgV auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Eingesetzte E-Vergabesysteme oder -Plattformen bieten in der Regel entsprechende Funktionalitäten. Im Übrigen gilt, dass die Vergabestelle beim Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel zu verwenden hat, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.
Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind mit einem Eingangsvermerk auf dem ungeöffneten Umschlag zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Fax übermittelte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. Bevor die Vergabestelle eine nicht-elektronische Einreichung vorsieht, hat er zu prüfen, ob eine solche Einreichungsform (noch) rechtlich zulässig ist. Die Vergabestelle darf nach § 55 VgV vom Inhalt der Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist Kenntnis nehmen. Die Öffnung der Angebote ist von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchzuführen. Anders als bei Vergabeverfahren im Baubereich wird bei Lieferungen und Leistungen keine öffentliche Submission (das heißt unter Beteiligung der Bieter) durchgeführt, sondern die Öffnung der Angebote erfolgt ausschließlich mit Mitarbeitern des Auftraggebers ohne jedwede Beteiligung von Bietern.
Die Öffnung der Angebote ist in Textform zu dokumentieren. Die Angebote sind nach der Öffnung vertraulich aufzubewahren.
3.5. Prüfung und Wertung der Angebote und Verhandlungen
Im Anschluss an die Öffnung der Erstangebote hat die Vergabestelle diese gemäß den vergaberechtlichen Vorschriften und insbesondere unter Berücksichtigung der in den Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben und Anforderungen zu prüfen und zu werten. Das konkrete Vorgehen bei der Prüfung und Wertung der Erstangebote und etwaiger Folgeangebote sowie insbesondere des endgültigen Angebotes wird auch die durch die vom Auftraggeber gewählte Gestaltung des Ablaufs des Verhandlungsverfahrens bestimmt. Insoweit ist zunächst als wesentlicher Unterschied des Verhandlungsverfahrens zum offenen und nicht offenen Verfahren zu beachten, dass das Nachverhandlungsverbot im Verhandlungsverfahren nicht gilt. Die Vergabestelle ist im Verhandlungsverfahren also berechtigt, über den Angebotsinhalt mit den Bietern zu verhandeln. Gleichwohl muss aber auch im Verhandlungsverfahren jedes Angebot den vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben und Anforderungen genügen. Das konkrete Vorgehen des Auftraggebers bei der Prüfung und Wertung der Angebote und bei den Verhandlungen bestimmt sich demgemäß nach den vom Auftraggeber im Rahmen des Designs, insbesondere bei der Erstellung der Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben zum Verfahrensablauf.
Gemäß § 17 Abs. 11 VgV kann die Vergabestelle den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er sich in der Auftragsbekanntmachung diese Möglichkeit vorbehalten hat. Hat die Vergabestelle hingegen keinen Vorbehalt der Auftragsvergabe auf der Grundlage der Erstangebote vorgesehen oder zieht er einen solchen vorgesehenen Vorbehalt im Vergabeverfahren tatsächlich nicht, bestehen keinen vergaberechtlichen Detailregelungen zum Ablauf des weiteren Vergabeverfahrens zwischen Erstangebot, Folgeangeboten und dem endgültigen Angebot. Der Auftraggeber hat insoweit Gestaltungsspielräume hinsichtlich des Ablaufs des weiteren Vergabeverfahrens, wobei die Vergabegrundsätze in jedem Stadium des Vergabeverfahrens stets zu beachten sind.
So kann die Vergabestelle zum Beispiel vorsehen, dass die Erstangebote zunächst nur indikative (unverbindliche) Angebote sind. Daneben besteht die Möglichkeit, das Erstangebot zunächst als reines Leistungsangebot anzufordern und erst nach Durchführung einer Verhandlungsrunde auch ein Preisangebot zu verlangen. Macht die Vergabestelle von solchen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, kommt allerdings keine Auftragsvergabe auf der Grundlage der Erstangebote in Betracht, weil diese Erstangebote dann gerade nicht verbindlich beziehungsweise nicht vollständig hinsichtlich der notwendigen Bestandteile (Preise) und damit nicht zuschlagsfähig sind. Die Vergabestelle kann zudem die Verhandlungen auch in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern („Abschichtung“). Voraussetzung dafür ist, dass er hierauf in der Auftragsbekanntmachung und in den Vergabeunterlagen hingewiesen hat.
Diese Besonderheiten des Verhandlungsverfahrens vorausgeschickt, geht die nachstehende Darstellung in folgender Reihenfolge auf die einzelnen Aspekte der Prüfung und Wertung von Angeboten und der Verhandlungen ein:
• Prüfung und Wertung der Erstangebote
• Verhandlungen
• Aufforderung zu Folgeangeboten und zum endgültigen Angebot
• Behandlung der Bieterfragen
• Öffnung der Folgeangebote und der endgültigen Angebote
• Prüfung und Wertung der Folgeangebote und der endgültigen Angebote
3.5.1. Prüfung und Wertung der Erstangebote
Hat die Vergabestelle einen Vorbehalt der Auftragsvergabe auf der Grundlage der Erstangebote gemäß § 17 Abs. 11 VgV in der Auftragsbekanntmachung aufgenommen und will er diesen Vorbehalt im Vergabeverfahren dann tatsächlich ziehen, folgt die Prüfung und Wertung der Erstangebote gemäß dem in der Praxis grundsätzlich angewandten 4-stufigen Wertungssystem:
• 1. Stufe: Formale Prüfung der Angebote
• (2. Stufe: Eignungsprüfung, bereits im Teilnahmewettbewerb durchgeführt)
• 3. Stufe: Prüfung der Angemessenheit des Preises
• 4. Stufe: Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes / Leistungsbewertung
Auf der 1. Stufe erfolgt dabei die formale Prüfung, insbesondere auf Vorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 56, 57 VgV. Auf der 2. Stufe nimmt die Vergabestelle die Eignungsprüfung vor, die im Verhandlungsverfahren bereits im Teilnahmewettbewerb vorgenommen wurde. Ein Neueinstieg in die Eignungsprüfung ist daher bei der Prüfung und Wertung der Angebote im Verhandlungsverfahren nur bei Änderungen oder neuen Feststellungen geboten, die das Ergebnis der Eignungsprüfung betreffen können. Auf der 3. Stufe geht es um die Prüfung der Angemessenheit und Auskömmlichkeit der Preise nach § 60 VgV. Erst auf der 4. Stufe erfolgt unter den danach in der Wertung verbliebenen Angebote die Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand der in den Vergabeunterlagen festgelegten Bewertungsmethode, bei der Einfachen und Erweiterten Richtwertmethode einschließlich der Leistungsbewertung nach der Leistungsbewertungsmatrix (siehe zu Bewertungsmethoden, Kriterienkatalog und Bewertungsmatrizen im Einzelnen Kapitel F.4.).
Hat die Vergabestelle
• hingegen keinen Vorbehalt der Auftragsvergabe auf der Grundlage der Erstangebote vorgesehen,
• oder zieht er einen solchen vorgesehenen Vorbehalt im Vergabeverfahren tatsächlich nicht,
• oder hat er das Vorgehen bei der Prüfung und Wertung der Erstangebote unter Berücksichtigung der Vergabevorschriften, insbesondere der Vergabegrundsätze in den Vergabeunterlagen entsprechend geregelt, kann das vorbeschriebene 4-stufige Wertungssystem möglicherweise nicht vollständig bei der Prüfung und Wertung der Erstangebote angewendet werden zum Beispiel, wenn
• keine abschließende formale Prüfung auf Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen erfolgen kann, weil die Erstangebote nach der Verfahrensgestaltung des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen gar nicht verbindlich sein mussten,
• oder keine Prüfung der Angemessenheit der Preise und keine Feststellung des (vorläufig) wirtschaftlichsten Angebotes möglich ist, weil noch gar keine Preisangebote mit dem Erstangebot verlangt wurden.
Im Folgenden wird dennoch das vollständige 4-stufige Wertungssystem im Einzelnen dargestellt. Ob und inwieweit dies im Einzelfall tatsächlich auf die Erstangebote angewandt wird, bestimmt sich nach den rechtmäßigen Vorgaben des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen.
3.5.1.1. Formale Prüfung der Angebote
Bei der formalen Prüfung prüft die Vergabestelle die Angebote auf Vollständigkeit, fachliche Richtigkeit und rechnerische Richtigkeit. Maßgeblich sind hierfür insbesondere die Vorgaben in den Vergabeunterlagen und der Auftragsbekanntmachung. Zudem umfasst die formale Prüfung die Prüfung auf das Vorliegen von Ausschlussgründen. Danach sind von der Angebotswertung zwingend auszuschließen:
• Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn der Bieter hat dies nicht zu vertreten
• Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthalten
• Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei sind
• Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vorgenommen worden sind
• Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen,
• nicht zugelassene Nebenangebote
Hat die Vergabestelle Nebenangebote zugelassen, so berücksichtigt er nur die Nebenangebote, die die von ihm in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Damit an sich vielversprechende Bieter nicht wegen lediglich geringfügiger formaler Fehler ausgeschlossen werden müssen, kann die Vergabestelle Bieter unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen (insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise) nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. Das Nachforderungsrecht darf jedoch nicht zum Austausch von Unterlagen genutzt werden, denn die Nachforderung bereits vorliegender, jedoch inhaltlich unzureichender Unterlagen ist nicht zulässig.
Grundsätzlich nicht nachgefordert werden dürfen leistungsbezogene Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen. Es sei denn, es handelt sich um Preisangaben für unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Die Entscheidung, ob er Unterlagen nachfordert, steht im Ermessen des Auftraggebers. Im Rahmen der Ermessensentscheidung muss darüber entschieden werden, ob nachgefordert wird, was nachgefordert wird und in welcher Frist nachzuliefern ist. Sowohl eine nach den obigen Ausführungen fehlerhafte Nachforderung von Unterlagen als auch eine danach fehlerhaft unterlassene Nachforderung kann dazu führen, dass die Vergabeentscheidung des Auftraggebers von Bietern angegriffen wird.
Die Vergabestelle kann die Nachforderung von Unterlagen bereits in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausschließen.
Sämtliche Entscheidungen, einschließlich der zugehörigen Begründungen im Rahmen der formalen Prüfung (insbesondere auch über die Ergebnisse der Prüfung auf Ausschlussgründe und für die Entscheidung über die Vornahme oder das Absehen von Nachforderungen) sind in der Vergabeakte zu dokumentieren.
3.5.1.2. Prüfung der Angemessenheit des Preises
Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit des Preises geht es um den richtigen Umgang mit ungewöhnlich niedrigen Angeboten. Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebotes im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig, hat die Vergabestelle vom Bieter Aufklärung zu verlangen. Ein automatischer Ausschlussgrund für solche Angebote besteht also gerade nicht (Grundsatz „Aufklärung vor Ausschluss“). Konkret treffen den Auftraggeber im Rahmen dieser Aufklärung folgende Pflichten:
Die Vergabestelle prüft die Zusammensetzung des Angebotes und berücksichtigt die übermittelten Unterlagen des Bieters.
Die Prüfung kann insbesondere betreffen:
• die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der Erbringung der Dienstleistung
• die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt
• die Besonderheiten der angebotenen Liefer- oder Dienstleistung
• die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Abs. 1 GWB, insbesondere der für das Unternehmen geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften
• oder die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen
Kann die Vergabestelle nach dieser Prüfung die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf das betroffene Angebot ablehnen. Eine Verpflichtung des Auftraggebers zur Ablehnung des betroffenen Angebotes besteht, wenn die Vergabestelle festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebotes ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach § 128 Abs. 1 GWB nicht eingehalten werden.
Stellt die Vergabestelle fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so ist die Vergabestelle verpflichtet, das Angebot abzulehnen, wenn der Bieter nicht fristgemäß nachweisen kann, dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Der Auftraggeber hat die Ablehnung in diesem Fall der Europäischen Kommission mitzuteilen. Anlass für eine Preisaufklärung geben zunächst Angebote mit auffälligen Preisdifferenzen zu eingegangenen Konkurrenzangeboten, wobei grundsätzlich der Gesamtpreis der Angebote maßgeblich ist. In Rechtsprechung und Landesvergabegesetzen werden teilweise prozentuale Preisabstände der Angebote zum nächsthöheren Angebot angenommen beziehungsweise festgelegt („Aufgreifschwellen“). Im Einzelfall sollte die Vergabestelle vertieft prüfen, ob und inwieweit solche Aufgreifschwellen in seinem Anwendungsbereich angenommen wurden oder gelten. Nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs können die Mitbewerber verlangen, dass der Auftraggeber in die nähere Prüfung der Preisbildung eintritt, wenn ein Angebotspreis aufgrund des signifikanten Abstands zum nächstgünstigen Angebot oder ähnlicher Anhaltspunkte, wie etwa der augenfälligen Abweichung von preislichen Erfahrungswerten aus anderen Beschaffungsvorgängen, ungewöhnlich niedrig erscheint (BGH, Beschluss vom 31.01.2017 – X ZB 10/16). Die vorzunehmende Preisaufklärung sollte sich unter Berücksichtigung dieses Grundsatzurteils nicht auf die Einholung einer pauschalen Bestätigung des betroffenen Bieters beschränken, die Angebotspreise seien angemessen und auskömmlich. Vielmehr ist eine qualifizierte Preisprüfung vorzunehmen, die insbesondere deren Schutzzweck berücksichtigt, auch das haushaltsrechtlich begründete Interesse des Auftraggebers und der Öffentlichkeit an der jeweils wirtschaftlichsten Beschaffung zu wahren.
Insoweit ist bei der Preisprüfung zu berücksichtigen, dass unangemessen niedrige Angebotspreise gesteigerte Risiken bergen. Nach dem Grundsatzurteil des BGH können sich diese in vielfältiger Weise verwirklichen, zum Beispiel:
• Auftragnehmer kann infolge der zu geringen Vergütung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und den Auftrag deshalb nicht vollständig ausführen.
• Auftragnehmer könnte in Anbetracht des zu niedrigen Preises versuchen, sich des Auftrages so unaufwendig wie möglich und insoweit auch nicht vertragsgerecht zu entledigen, durch möglichst viele Nachträge Kompensation zu erhalten oder die Ressourcen seines Unternehmens auf besser bezahlte Aufträge zu verlagern, sobald sich die Möglichkeit dazu bietet.
Die Vergabestelle sollte diese Aspekte bei der Preisaufklärung entsprechend berücksichtigen. Kann der betroffene Bieter seine ungewöhnlich niedrig erscheinenden Preise aber rechtmäßig erklären und die Gründe für seine Preisbildung eindeutig und transparent machen, kann aber auch ein ungewöhnlich niedrig erscheinendes Angebot zulässig sein. Dies mit der Folge, dass ein solches Angebot nicht ausgeschlossen werden darf.
Zu Dokumentations- und Beweiszwecken ist die Durchführung der Aufklärung (Aufklärungsverlangen und Stellungnahme des betroffenen Bieters hierzu) in Textform zu dokumentieren. Für die Aufklärung durch den Bieter ist diesem eine angemessene Frist zu gewähren. In der Praxis kann für den Auftraggeber die Ausrichtung des Aufklärungsverlangens anhand konkreter Positionen des Angebotes / Preisblattes hilfreich sein, aus denen der ungewöhnlich niedrig erscheinende Gesamtpreis mutmaßlich resultiert.
Anhand der im Rahmen der Aufklärung vom betroffenen Bieter eingereichten Unterlagen hat der Auftraggeber zu prüfen, ob danach die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten zufriedenstellend aufgeklärt sind. Nur wenn dies nicht der Fall ist, darf die Vergabestelle den Zuschlag auf das betroffene Angebot ablehnen. Eine Verpflichtung des Auftraggebers zur Ablehnung des betroffenen Angebotes besteht, wenn die Vergabestelle festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebotes ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach § 128 Abs. 1 GWB nicht eingehalten werden.
Die Vergabestelle darf von den Bietern Aufklärung über das Angebot, insbesondere im Zusammenhang mit den angebotenen Preisen nach den vorstehenden Maßstäben verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen der Angebote oder Preise, sind unzulässig. Sämtliche Entscheidungen, einschließlich der zugehörigen Begründungen im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit der Preise (insbesondere über eine etwaige Aufklärung mit den betroffenen Bietern und über das Ergebnis, einschließlich Begründung der anschließenden Wertungsentscheidung des Auftraggebers) sind in der Vergabeakte zu dokumentieren.
3.5.1.3. Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes / Leistungsbewertung
Erst im Rahmen der Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes kommt – für die nach den drei vorstehend dargestellten Wertungsstufen im Wettbewerb verbliebenen Angebote – die in den Vergabeunterlagen hinsichtlich der Zuschlagskriterien festgelegte Bewertungsmethode, gegebenenfalls nebst zugehöriger Leistungsbewertung gemäß Leistungsbewertungsmatrix zum Tragen. Die Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt demgemäß nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf der Grundlage einer Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die in den Vergabeunterlagen durch Bewertungsmethode gegebenenfalls Leistungsbewertungsmatrix vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt.
Die Vergabestelle ist dabei gehalten, die und nur die Bewertungsmethode und gegebenenfalls Leistungsbewertungsmatrix anzuwenden, die er im Rahmen der Planung und Designs einer Beschaffung, insbesondere in den Vergabeunterlagen, rechtmäßig festgelegt und definiert hat. Der Auftraggeber darf keine Unterkriterien, Gewichtungsregeln, Punkte- oder sonstige Bewertungssysteme anwenden, die er den am Auftrag interessierten Unternehmen nicht vorher zur Kenntnis gebracht hat. Eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung der Zuschlagskriterien, Bewertungsmethode und gegebenenfalls Leistungsbewertungsmatrix ist grundsätzlich unzulässig. Sämtliche Entscheidungen, einschließlich der zugehörigen Begründungen im Rahmen der Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes, insbesondere der Leistungsbewertung nach einer Leistungsbewertungsmatrix (insbesondere über das Ergebnis der Bewertung unter den einzelnen B-Kriterien, einschließlich Begründung) sind in der Vergabeakte zu dokumentieren. Bei B-Kriterien mit Beurteilungsspielräumen für den Auftraggeber bei der Bewertung bedarf es im Rahmen der Leistungsbewertung einer besonders sorgfältigen Begründung und einer entsprechenden Dokumentation durch den Auftraggeber.
3.5.2. Verhandlungen
Für den Fall, dass nach den oben beschriebenen Maßgaben keine Auftragsvergabe auf der Grundlage der Erstangebot erfolgt, tritt die Vergabestelle nach der vorbeschriebenen Prüfung und Wertung der Erstangebote in die Verhandlungen ein. Eine Verhandlungsrunde besteht aus einem oder mehreren Verhandlungsgesprächen, die einzeln mit allen Bietern geführt werden, soweit keine Abschichtung stattgefunden hat. Innerhalb eines Verhandlungsverfahrens kann es zu einer oder mehreren Verhandlungsrunden kommen. Zum Abschluss einer Verhandlungsrunde werden regelmäßig entweder Folgeangebote eingeholt und / oder Verhandlungsergebnisse verbindlich schriftlich fixiert.
Die Vergabestelle verhandelt im Rahmen einer Verhandlungsrunde mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Um die Flexibilität für die Verhandlungen zu wahren, sollte die Vergabestelle daher mit der Festlegung von Mindestanforderungen zurückhaltend sein und grundsätzlich nur alternativlose Leistungsanforderungen und Funktionalitäten als Mindestanforderung im Sinne von den vorgenannten Vorschriften festlegen. Im Rahmen der Verhandlungen kann gegebenenfalls mehrfach sowohl über Leistungen als auch über Preise verhandelt werden.
Vor allem in komplexen und lang laufenden Verhandlungsverfahren kann es sinnvoll sein, protokollierte Verhandlungsergebnisse unmittelbar am Ende der Verhandlungsergebnisse von allen Verhandlungsbeteiligten durch Unterschrift bestätigen zu lassen oder zumindest im Anschluss an die Verhandlungsbeteiligten an die Verhandlungsbeteiligten zu übermitteln. Dabei können die Bieter aufgefordert werden, zum Beispiel bestimmte Angebotsteile auf Grundlage des protokollierten Verhandlungsergebnisses zu überarbeiten. Die Veranlassung einer derartigen Überarbeitung von Angebotsteilen muss nicht zwingend als formale Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgen, sondern kann auch informell, beispielsweise zur Vorbereitung eines weiteren Verhandlungsgesprächs, von Bietern verlangt werden. Wenn die Vergabestelle hier die Verbindlichkeit der Überarbeitung sicherstellen möchte, kann er die Unterzeichnung solcher Dokumente verlangen. Aus Gründen der Gleichbehandlung sind allen Bietern gleiche Fristen für Überarbeitungen zu setzen.
Die Vergabestelle hat bei den Verhandlungen sicherzustellen, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleichbehandelt werden. Insbesondere hat sich die Vergabestelle jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen zu enthalten, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Die Vergabestelle darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden. Bieter, deren Angebote nicht im Rahmen einer „Abschichtung“ (phasenweises Verhandlungsverfahren) ausgeschieden sind, sind in Textform nach § 126b BGB über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen zu unterrichten, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen hat der Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit zu gewähren, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen.
Wenn die Vergabestelle ein phasenweises Verhandlungsverfahren mit „Abschichtung“ vorgesehen hat, erfolgt die Abschichtung in der Regel bereits vor der Verhandlungsrunde anhand der eingereichten Erstangebote (gegebenenfalls Folgeangebote). Diese Bieter sind unter Angabe von Gründen über ihr Ausscheiden aus dem Vergabeverfahren zu informieren. Gleiches gilt für Bieter, deren Angebote zum Beispiel aus formalen Gründen auszuschließen sind.
Die Verhandlungen sollten so lange geführt werden, bis die letzte Verhandlungsrunde die Möglichkeit zur Einholung endgültiger zuschlagsreifer Angebote eröffnet hat.
3.5.3. Aufforderung zu Folgeangeboten und zum endgültigen Angebot
Wenn die Vergabestelle beabsichtigt, die Verhandlungen abzuschließen, so unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung neuer oder überarbeiteter Angebote (Folgeangebote oder endgültige Angebote) fest. Dabei ist jeweils eindeutig anzugeben, ob es sich (lediglich) um ein Folgeangebot oder das endgültige Angebot handelt.
Die Aufforderung zur Abgabe von Folgeangeboten und endgültigen Angeboten enthält regelmäßig die Bezeichnung des Vergabeverfahrens, das Aktenzeichen und möglicherweise ein Begleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen. Weiterhin sollte der Aufbau der gegebenenfalls aktualisierten Vergabeunterlagen in einer Übersicht dargestellt werden und die Angebotsfrist sowie die Stelle, bei der das Angebot oder die angeforderten Unterlagen einzureichen sind, benannt werden. Gegebenenfalls sind in der Aufforderung zur Abgabe von Folgeangeboten und endgültigen Angeboten auch Angaben zum weiteren Verfahrensablauf mitzuteilen, insbesondere wenn sich dieser gegenüber den vorherigen Ankündigungen ändert. Wenn die Vergabestelle ein phasenweises Verhandlungsverfahren mit „Abschichtung“ vorgesehen hat, werden nur noch die im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter zum Folgeangebot beziehungsweise zum endgültigen Angebot aufgefordert. Nach Abschluss der letzten Verhandlungsrunde erfolgt als sogenannter „last call“ die Aufforderung zum endgültigen Angebot an die bis dahin im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter („best and final offer“ – BAFO).
3.5.4. Behandlung der Bieterfragen
Innerhalb der Angebotsfrist für Folgeangebote und das endgültige Angebot können die Bieter zusätzliche sachdienliche Auskünfte erbitten. Der konkrete Ablauf der Behandlung von Bieterfragen ist bereits bei der Behandlung von Bieterfragen vor den Erstangeboten dargestellt, auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.
3.5.5. Behandlung und Öffnung der Folgeangebote und der endgültigen Angebote
Elektronisch übermittelte Angebote sind nach § 54 VgV auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Eingesetzte E-Vergabesysteme oder -Plattformen bieten in der Regel entsprechende Funktionalitäten. Im Übrigen gilt, dass die Vergabestelle beim Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel zu verwenden hat, die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind mit einem Eingangsvermerk auf dem ungeöffneten Umschlag zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Fax übermittelte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. Bevor die Vergabestelle eine nicht-elektronische Einreichung vorsieht, hat er zu prüfen, ob eine solche Einreichungsform (noch) rechtlich zulässig ist. Die Vergabestelle darf nach § 55 VgV vom Inhalt der Folgeangebote und endgültigen Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist Kenntnis nehmen. Die Öffnung der Folgeangebote und endgültigen Angebote ist von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchzuführen. Bei Lieferungen und Leistungen wird keine öffentliche Submission (das heißt unter Beteiligung der Bieter) durchgeführt, sondern die Öffnung der Folgeangebote und endgültigen Angebote erfolgt ausschließlich mit Mitarbeitern des Auftraggebers ohne jedwede Beteiligung von Bietern. Die Öffnung der Folgeangebote und endgültigen Angebote ist in Textform zu dokumentieren. Die Folgeangebote und endgültigen Angebote sind nach der Öffnung vertraulich aufzubewahren.
3.5.6. Prüfung und Wertung der Folgeangebote und der endgültigen Angebote
Im Anschluss an die Öffnung der Folgeangebote und endgültigen Angebote hat die Vergabestelle diese gemäß den vergaberechtlichen Vorschriften und insbesondere unter Berücksichtigung der in den Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben und Anforderungen zu prüfen und zu werten. Das konkrete Vorgehen bei der Prüfung und Wertung der Folgeangebote und insbesondere des endgültigen Angebotes wird auch die durch die vom Auftraggeber gewählte Gestaltung des Ablaufs des Verhandlungsverfahrens bestimmt. Das konkrete Vorgehen des Auftraggebers bei der Prüfung und Wertung der Angebote und bei den Verhandlungen bestimmt sich demgemäß nach den vom Auftraggeber im Rahmen des Designs, insbesondere bei der Erstellung der Vergabeunterlagen aufgestellten Vorgaben zum Verfahrensablauf. Spätestens hinsichtlich der endgültigen Angebote erfolgt die Prüfung und Wertung der gemäß dem in der Praxis grundsätzlich angewandten 4-stufigen Wertungssystem:
• 1. Stufe: Formale Prüfung der Angebote
• (2. Stufe: Eignungsprüfung, bereits im Teilnahmewettbewerb durchgeführt)
• 3. Stufe: Prüfung der Angemessenheit des Preises
• 4. Stufe: Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes / Leistungsbewertung
Auf der 1. Stufe erfolgt dabei die formale Prüfung, insbesondere auf Vorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 56, 57 VgV. Auf der 2. Stufe nimmt die Vergabestelle die Eignungsprüfung vor, die im Verhandlungsverfahren bereits im Teilnahmewettbewerb vorgenommenen wurde. Ein Neueinstieg in
die Eignungsprüfung ist daher bei der Prüfung und Wertung der Angebote im Verhandlungsverfahren nur bei Änderungen oder neuen Feststellungen geboten, die das Ergebnis der Eignungsprüfung betreffen können. Auf der 3. Stufe geht es um die Prüfung der Angemessenheit und Auskömmlichkeit der Preise nach § 60 VgV. Erst auf der 4. Stufe erfolgt, unter den danach in der Wertung verbliebenen Angeboten, die Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes, anhand der in den Vergabeunterlagen festgelegten Bewertungsmethode, bei der Einfachen und Erweiterten Richtwertmethode einschließlich der Leistungsbewertung nach der Leistungsbewertungsmatrix.
Der konkrete Ablauf der formalen Prüfung, Prüfung der Angemessenheit des Preises sowie die Feststellung des wirtschaftlichsten Angebotes / Leistungsbewertung ist bereits bei der Prüfung und Wertung der Erstangebote dargestellt, auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.
3.6. Zuschlagsphase
3.6.1. Zuschlagsentscheidung beziehungsweise Verfahrensaufhebung
Im Regelfall endet das Vergabeverfahren mit einer Zuschlagsentscheidung. Voraussetzung dafür ist, dass nach Abschluss der Prüfungs- / Wertungsphase mindestens ein zuschlagsfähiges Angebot vorliegt, das auch zu einem wirtschaftlichen Ergebnis des Vergabeverfahrens führt.
3.6.1.1. Vorbereitung der Zuschlagsentscheidung
Sofern die Vergabestelle im Verhandlungsverfahren den Zuschlag auf ein Erstangebot erteilen will, ohne in Verhandlungen eingetreten zu sein, ist dies nur möglich, wenn dieses Vorgehen in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung mitgeteilt wurde (§ 17 Abs. 9 VgV). Dieser Aspekt ist je nach Verfahrenslage zu prüfen. Vor Zuschlagserteilung kann die Vergabestelle zudem von den Bietern, die eine Unterauftragsvergabe an Dritte vorsehen und deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, noch nicht aufgelistete Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen (sogenannte Mittelbereitstellungserklärung). Er muss dann auch die Einreichung entsprechender Angaben fordern, um das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen prüfen zu können (§ 36 Abs. 1 VgV). Der öffentliche Auftraggeber überprüft in jedem Fall vor der Erteilung des Zuschlages, ob Gründe für den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Ausschlussgründe verlangt der öffentliche Auftraggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Bei Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt wird. Der öffentliche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist setzen (§ 36 Abs. 5 VgV).
3.6.1.2. Zuschlagsentscheidung
Nach Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes im Rahmen der Prüfungs- / Wertungsphase ist die Zuschlagsentscheidung herbeizuführen. Sowohl die Grundlagen für die Zuschlagsentscheidung als auch die Gründe der Nichtberücksichtigung der restlichen Bewerber und Bieter sind in der Vergabeakte zu dokumentieren. An der Entscheidung über den Zuschlag sollen nach § 58 Abs. 5 VgV in der Regel mindestens zwei Vertreter des öffentlichen Auftraggebers mitwirken (Mitzeichnung ist erforderlich).
Sofern demgegenüber keine zuschlagsfähigen Angebote vorliegen oder andere Aufhebungsgründe zutreffen, so ist das Vergabeverfahren unter Berücksichtigung der Regelung des § 63 VgV ganz oder losweise aufzuheben.
3.6.1.3. Aufhebung
Nach § 63 VgV kann die Vergabestelle das Vergabeverfahren nach den in der Norm genannten und eng begrenzten Tatbeständen durch eine rechtmäßige Aufhebung beenden. Grundsätzlich gilt, dass Auftraggeber Vergabeverfahren nicht willkürlich aufheben dürfen. Ein „Auslaufen“ eines Vergabeverfahrens ohne einen für die Bieter erkennbaren Abschluss und dementsprechende Information durch den Auftraggeber ist nicht zulässig. Der früheste Zeitpunkt einer möglichen Aufhebung ist unmittelbar nach erfolgter Bekanntmachung des Vergabeverfahrens oder Aufforderung zur Angebotsabgabe.
Diese Aufhebungsvoraussetzungen sind im Einzelfall zu prüfen. Allerdings darf die Vergabestelle auch dann, wenn keine der gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen, das Verfahren aufheben. Er ist also nicht gezwungen, den Zuschlag zu erteilen. Ein sonstiger zwingender Aufhebungsgrund kann beispielsweise bestehen, wenn aufgrund fehlerhafter Planungen bereits ursprünglich nicht verfügbare Haushaltsmittel für den Auftrag endgültig verweigert werden. Ohne das Vorliegen einer gesetzlichen Aufhebungsvoraussetzung können Bewerber oder Bieter jedoch unter Umständen erfolgreich Schadensersatzansprüche gegenüber dem Auftraggeber geltend machen. Es ist zwischen einer Vollaufhebung und einer Teilaufhebung zu unterscheiden. Damit bei losweisen Vergaben nicht alle Beschaffungsmaßnahmen betroffen sind, ist grundsätzlich eine Teilaufhebung für das betreffende Los möglich.
Nach der Entscheidung über die Aufhebung des Vergabeverfahrens hat die Vergabestelle den Bewerbern oder Bietern unverzüglich die Gründe für seine Entscheidung mitzuteilen, auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten. Diese Mitteilung kann formfrei erfolgen, muss auf Antrag eines Bewerbers oder Bieters jedoch in Textform (gemäß § 126b BGB) übermittelt werden. Aus Dokumentationsgründen sollte jedoch von vornherein die Textform gewählt werden.
3.6.2. Abfrage beim Gewerbezentralregister
Das MiLoG trifft in § 19 MiLoG Regelungen zum Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge. Auf dieser Grundlage sind Auftraggeber verpflichtet, Bieter vor dem Zuschlag hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften des MiLoG zu überprüfen (Eigenerklärung ist zu verlangen). Darüber hinaus muss bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a GewO eingeholt werden (auch „MiLoG-Abfrage“ genannt). Diese Auskunft sollte im Sinne eines zügigen Abschlusses des Vergabeverfahrens unverzüglich nach der Zuschlagsentscheidung beim zuständigen Bundesamt für Justiz angefordert werden. Sofern der Bieter ausweislich der Gewerbezentralregisterauskunft mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist, soll dies zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. Vor einer Entscheidung über den etwaigen Ausschluss ist dem Bieter eine Gelegenheit einzuräumen, sich zu dem Sachverhalt zu äußern. Aus Dokumentationsgründen sollte die Anhörung des Bieters in Textform (gemäß § 126b BGB) erfolgen. Bei der zu treffenden Entscheidung über den Ausschluss auf Grundlage der Ausführungen eines Bieters ist es naheliegend, dass die Vergabestelle sich an den Grundsätzen der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB orientiert.
3.6.3. Information der nicht berücksichtigten Bieter
3.6.3.1. Informations- und Wartepflicht
Im Rahmen der Informations- und Wartepflicht nach § 134 GWB muss die Vergabestelle vor der Zuschlagserteilung an alle Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, ein Informationsschreiben übermitteln. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Diese Information muss unverzüglich nach der Zuschlagsentscheidung und in Textform (gemäß § 126b BGB) erfolgen. Die Ablehnungsbegründung muss auf die im Einzelfall tragenden Gründe eingehen.
3.6.3.2. Inhalt des Informationsschreibens
Das Informationsschreiben muss mindestens folgende Informationen beinhalten:
• Angabe des Namens des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll
• Individueller und begründeter Ablehnungsgrund
• Frühester Zeitpunkt des Vertragsschlusses
Hinsichtlich des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, genügt die Angabe des Namens (notwendig ist also nicht die Angabe der Adresse etc.).
3.6.3.3. Bemessung der Wartefrist
Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information per Telefax oder auf elektronischem Weg (zum Beispiel über ein E-Vergabe-System oder per E-Mail) übermittelt, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist der 15 Kalendertage beziehungsweise zehn Kalendertage beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.
3.6.3.4. Begründung der vorgesehenen Nichtberücksichtigung eines Angebotes
Die Ausführlichkeit der Begründung der vorgesehenen Nichtberücksichtigung eines Angebotes hängt vom Einzelfall ab, beispielsweise von der Komplexität der Bewertungsmethode. Die Begründung der vorgesehenen Nichtberücksichtigung eines Angebotes muss jedenfalls auf die konkreten im Einzelfall tragenden Gründe eingehen. Ein bloßer allgemeiner Hinweis darauf, dass das Angebot ausgeschlossen werden musste oder nicht das wirtschaftlichste gewesen ist, genügt im Regelfall den Anforderungen an die zu übermittelnden Inhalte gemäß der Informationspflicht nicht, auch wenn die Begründung grundsätzlich knapp ausfallen kann.
Folgende Grundsätze sollte man bei der Angabe von Gründen für die vorgesehene Nichtberücksichtigung beachten:
• Es sind vollständige Informationen und somit alle Gründe für die vorgesehene Nichtberücksichtigung anzugeben. Ist ein Angebot beispielsweise sowohl verspätet als auch in Form eines Nebenangebotes eingegangen, obwohl Nebenangebote nicht zugelassen wurden, so liegen zwei Gründe für die Nichtberücksichtigung vor (ein Ausschluss muss nach § 57 Abs. 1 Nr. 1, 6 VgV erfolgen), die mitgeteilt werden sollten.
• Sofern ein Bieter nicht zu berücksichtigen ist, weil er nicht das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat, sollten – je nach der anzuwendenden Bewertungsmethode – konkretisierende Informationen mitgeteilt werden. Ist über den Zuschlag auf Grundlage des günstigsten Preises beziehungsweise der niedrigsten Kosten zu entscheiden, so istempfehlenswert,
• dem Bieter mitzuteilen, welchen Rang das Angebot in der Rangfolge der Preise beziehungsweise der Kosten belegt hat. Erfolgt die Zuschlagserteilung auf Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses, so ist empfehlenswert, dem Bieter mitzuteilen, ob sein Angebot anhand eines teureren Preises oder anhand niedrigerer Leistungspunkte als der Zuschlagskandidat oder aus beiden Gründen nicht berücksichtigt werden kann, gegebenenfalls ergänzt um die jeweilige Rangfolge.
• Insgesamt sollen die Informationen aussagekräftig und für den Bieter nachvollziehbar sein.
• Allen Bietern, die nicht berücksichtigt werden, sollen aus Gründen der Gleichbehandlung die sie betreffenden Informationen in gleichartiger Ausgestaltung und Ausführlichkeit sowie zum gleichen Zeitpunkt übermittelt werden. Darüber hinausgehende Informationen werden regelmäßig nicht erforderlich sein. Insbesondere ist eine Angabe von konkreten Leistungspunktzahlen nicht notwendig. Konkrete Informationen über das Angebot, das den Zuschlag erhalten soll, sollen nicht mitgeteilt werden, da die Vergabestelle die Vertraulichkeit von Informationen aus dem Angebot des Zuschlagskandidaten zu wahren hat, was
insbesondere die Preisangaben betrifft. Ein ähnlicher Maßstab kann grundsätzlich für die Begründung der vorgesehenen Nichtberücksichtigung eines Teilnahmeantrages angelegt werden.
3.6.3.5. Adressaten des Informationsschreibens
Adressaten des Informationsschreibens sind alle Bieter, das heißt Unternehmen, die sich am Vergabeverfahren durch Abgabe eines Angebotes beteiligt haben. Darunter fällt beispielsweise auch das Angebot eines Bieters, das bereits deshalb ausgeschlossen werden musste, weil es verspätet eingegangen war. Daneben sind auch Bewerber Adressaten des Informationsschreibens, denen bis dato noch keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde. Um den Kreis von Adressaten in der Zuschlagsphase klein zu halten sowie aus Transparenzgründen, empfiehlt es sich, ausgeschiedenen Bewerbern bereits nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes eine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zu übermitteln. Eine Übermittlung des Informationsschreibens an den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, ist nicht vorgeschrieben, kann aber sinnvoll sein, damit dieser Bieter bereits Vorkehrungen für die Aufnahme der Leistungserbringung treffen kann. Erfolgt eine solche Benachrichtigung, so ist darauf zu achten, dass klarstellend nur die voraussichtliche Zuschlags- beziehungsweise Auftragserteilung angekündigt wird. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, die Vorankündigung sei bereits das eigentliche Zuschlagschreiben.
3.6.3.6. Konsequenzen einer Nichtbeachtung der Informations- und Wartepflicht
Erfolgt die Information nicht oder nur unvollständig beziehungsweise nicht gegenüber allen notwendigen Adressaten oder wird die Wartefrist nicht eingehalten und trotzdem der Zuschlag erteilt, so hat dies gravierende Folgen. Denn ein erteilter öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber gegen die Vorschriften zur Informations- und Wartepflicht nach § 134 GWB verstoßen hat und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Die Unwirksamkeit kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrages beziehungsweise nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union geltend gemacht worden ist, längstens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Vertragsschluss. Zur Vermeidung vorgenannter Risiken sollte die Vergabestelle bei Abfassung und Versand des Informationsschreibens ein hohes Maß an Sorgfalt walten lassen.
3.6.3.7. Ergänzende Informationspflichten und Informationspflicht auf Antrag
Unabhängig von der vorstehend dargestellten gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflicht nach § 134 GWB gegenüber nicht berücksichtigten Bietern und Bewerbern, bestehen nach § 62 VgV ergänzende Informationspflichten gegenüber Bewerbern und Bietern. Daneben können Bieter und Bewerber gezielt weitergehende Informationen über die Gründe der Nichtberücksichtigung vom Auftraggeber verlangen.
Die Vergabestelle muss jedem Bieter und jedem Bewerber unverzüglich und ohne gesonderte Aufforderung seine Entscheidungen über
• den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder
• die Zuschlagserteilung
mitteilen.
Es empfiehlt sich, diese Informationen in das Informationsschreiben nach § 134 GWB aufzunehmen (soweit hier überhaupt ein zusätzlicher Gehalt an Informationen zu verzeichnen ist). Eine Information nach § 62 Abs. 1 VgV kann aber das Informationsschreiben nach § 134 GWB nicht ersetzen. Weiterhin muss die Vergabestelle in der Zuschlagsphase auf Verlangen eines Bewerbers oder Bieters diesen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrages in Textform (gemäß § 126b BGB),
• jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahmeantrages (1)
• jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebotes (2) und
• über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes (3) sowie
• den Namen des erfolgreichen Bieters (4)
informieren.
Die Informationsaspekte (2) und (4) werden bereits mit dem Informationsschreiben nach § 134 GWB abgedeckt. Demgegenüber stellen nur die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes noch eine zusätzliche Information dar. Der Spielraum für solche Informationen über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes ist allerdings aus Gründen des Vertraulichkeitsschutzes und des fairen Wettbewerbes nur sehr klein. Man wird hier kaum weiter gehen können, als etwa dem nicht erfolgreichen Bieter in allgemeiner Form mitzuteilen, in welchen Leistungsbereichen (zum Beispiel Kriterienhauptgruppen oder Kriteriengruppen) der Zuschlagskandidat besser abgeschnitten hat als der nicht erfolgreiche Bieter. Aufgrund des Vertraulichkeitsschutzes gemäß § 5 VgV, der die vertraulichen Aspekte des Angebotes des Zuschlagskandidaten regelt, ist insbesondere hinsichtlich etwaiger Preisinformationen größte Zurückhaltung geboten. Bei der Darstellung der Gründe für die Ablehnung eines Teilnahmeantrages (1) kann man sich hinsichtlich Ausführlichkeit und Substanz an den Ausführungen zur Begründung der vorgesehenen Nichtberücksichtigung eines Angebotes orientieren.
Der öffentliche Auftraggeber ist im Übrigen nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn deren Veröffentlichung den Gesetzesvollzug behindern (a), dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen (b), den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden (c) oder den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen würde (d). Insbesondere die genannten Aspekte (c) und (d) sprechen dafür, dass die Vergabestelle bei der antragsgemäßen Information über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes ein hohes Maß an Zurückhaltung walten lässt.
3.6.4. Zuschlagserteilung und Vertragsschluss
3.6.4.1. Übermittlung Zuschlagsschreiben
Nach Ablauf der Wartefrist ist im nächsten Schritt der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Zum Vertragsschluss muss die Vergabestelle dem ausgewählten Bieter ein Zuschlagsschreiben übermitteln. In dem Zuschlagsschreiben ist dem Bieter mitzuteilen, dass der Zuschlag erteilt wird und das Angebot des Bieters angenommen wird. Dabei ist in der VgV – anders als ausdrücklich an diversen anderen Stellen bezüglich der Kommunikation – nicht die Textform (§ 126b BGB), allerdings auch keine andere spezifische Form (zum Beispiel die Schriftform), vorgesehen. Insofern ist von einer Wahlfreiheit des Auftraggebers hinsichtlich der Übermittlungsform auszugehen. Allerdings sollte der Auftraggeber auf die Nachweisbarkeit des Zugangs des Zuschlagsschreibens achten. Mit Zugang des Zuschlagsschreibens beim Bieter kommt der Vertrag zustande. Dabei gelten die Grundsätze zum Vertragsschluss nach dem BGB. Das Zuschlagsschreiben muss daher dem Bieter rechtzeitig vor Ablauf der Zuschlagsfrist und vor allem noch innerhalb der Angebotsbindefrist zugehen. Daneben darf die Annahme des Angebotes im Zuschlagsschreiben nicht an Bedingungen geknüpft sein oder eine Änderung des Angebotes oder der Vertragsunterlagen enthalten.
Soll die festgelegte Zuschlagsfrist aus wichtigen Gründen verlängert werden, so ist das Einverständnis der zu diesem Zeitpunkt noch im Vergabeverfahren befindlichen Bieter einzuholen. Es kann auch nur die Zustimmung derjenigen Bieter eingeholt werden, die noch eine Chance auf eine Zuschlagserteilung haben. Bei dieser Gelegenheit sind die Bieter auch aufzufordern, einer Verlängerung der Angebotsbindefrist zuzustimmen, soweit deren Fristende vor dem Ende der verlängerten Zuschlagsfrist liegt.
3.6.4.2. Erstellung der Vertragsurkunde
Nach Übermittlung des Zuschlagsschreibens wird zur Verfahrensdokumentation regelmäßig eine Vertragsurkunde ausgefertigt. Der Inhalt dieser Vertragsurkunde ergibt sich im Wesentlichen aus den Vertragsunterlagen (die Bestandteil der Vergabeunterlagen waren) und dem Angebot. Bei kleineren Beschaffungen kann auf die Ausfertigung einer gesonderten Vertragsurkunde verzichtet werden. Der Vertragsinhalt ergibt sich dann etwa aus der Leistungsbeschreibung, der VOL/B und dem Angebot. Die Vertragsunterlagen – beispielsweise die bereits weitestgehend vorausgefüllten EVB-IT Vertragsformulare – sind im Wege einer Konsolidierung mit den notwendigen Informationen aus dem Angebot zu vervollständigen. Der Vertragsinhalt ist bereits mit Zuschlagserteilung und Übermittlung des Zuschlagsschreibens wirksam festgelegt und darf im Zuge der Erstellung der Vertragsurkunde nicht geändert werden.
3.6.4.3. Unterzeichnung der Vertragsurkunde
Die Unterzeichnung der Vertragsurkunde durch die Vertragspartner dient der Beweissicherung und trägt zur Rechtssicherheit bei. Die Vergabestelle übermittelt dem Auftragnehmer beispielsweise zwei Vertragsurkunden, von denen eine bereits von die Vergabestelleseite gezeichnet ist und beim Auftragnehmer verbleibt, während der Auftragnehmer die andere nach Unterzeichnung an den Auftraggeber zurücksendet. Zu Dokumentationszwecken sollten der abzulegenden Vertragsurkunde alle Vertragsanlagen beigefügt werden.
3.6.5. Bekanntmachungspflichten sowie Verfahrensabschluss
3.6.5.1. Vergabebekanntmachung und Statistikmeldungen
Die Vergabestelle muss spätestens 30 Tage nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrages – also nach der Auftragserteilung mittels Übermittlung des Zuschlagsschreibens – oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermitteln (Formular: Bekanntmachung vergebener Aufträge – Ergebnisse des Vergabeverfahrens).
Bei Abschluss einer Rahmenvereinbarung bezieht sich die Bekanntmachung vergebener Aufträge nur auf die abgeschlossene Rahmenvereinbarung. Für die auf ihrer Grundlage vergebenen Einzelaufträge ist keine Bekanntmachung vergebener Aufträge erforderlich. Daneben sieht die VergStatVO für den Auftraggeber bestimmte Pflichten zur Übermittlung von statistikrelevanten Daten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vor, die zu beachten sind.
3.6.5.2. Abschluss des Vergabeverfahrens
Das Vergabeverfahren ist in der Regel mit der Auftragserteilung durch Übermittlung des Zuschlagsschreibens beendet. Bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Bietern wirkt das Vergabeverfahren jedoch noch fort, soweit nach den Regelungen der Rahmenvereinbarung mittels erneuten Vergabeverfahrens zwischen den Unternehmen, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind, also sogenannten Miniwettbewerben, Einzelaufträge vergeben werden. Auch diese Vergaben von Einzelaufträgen unterliegen dann noch den vergaberechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Vertragsunterlagen sind mit Abschluss des Vergabeverfahrens an die für die Vertragsverwaltung zuständige Stelle zu übermitteln.
3.6.5.3. Aufbewahrung der Unterlagen
Nach Abschluss des Vergabeverfahrens ist die Vergabeakte auf Vollständigkeit zu prüfen und zu archivieren. Die gesamte Verfahrensdokumentation, der Vergabevermerk, die Teilnahmeanträge sowie die Angebote und ihre Anlagen sind gemäß § 8 Abs. 4 VgV bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages. Gleiches gilt für Kopien aller abgeschlossenen Verträge, die mindestens einen Auftragswert in Höhe von einer Million Euro haben. Gegebenenfalls müssen die Vergabeunterlagen sowie die gesamte Vergabeakte mit deren Anlagen entsprechend den für den Auftraggeber geltenden Aufbewahrungsvorschriften und -fristen noch länger als die vorgenannte dem Vergaberecht entstammende Frist aufbewahrt werden. Wichtig ist dies unter anderem auch zum Zweck einer etwaigen Prüfung der vergaberechtlichen Relevanz späterer Vertragsänderungen, weil dann die ursprünglichen Vergabeunterlagen regelmäßig nochmals geprüft werden müssen. Die Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote sind im Übrigen auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.