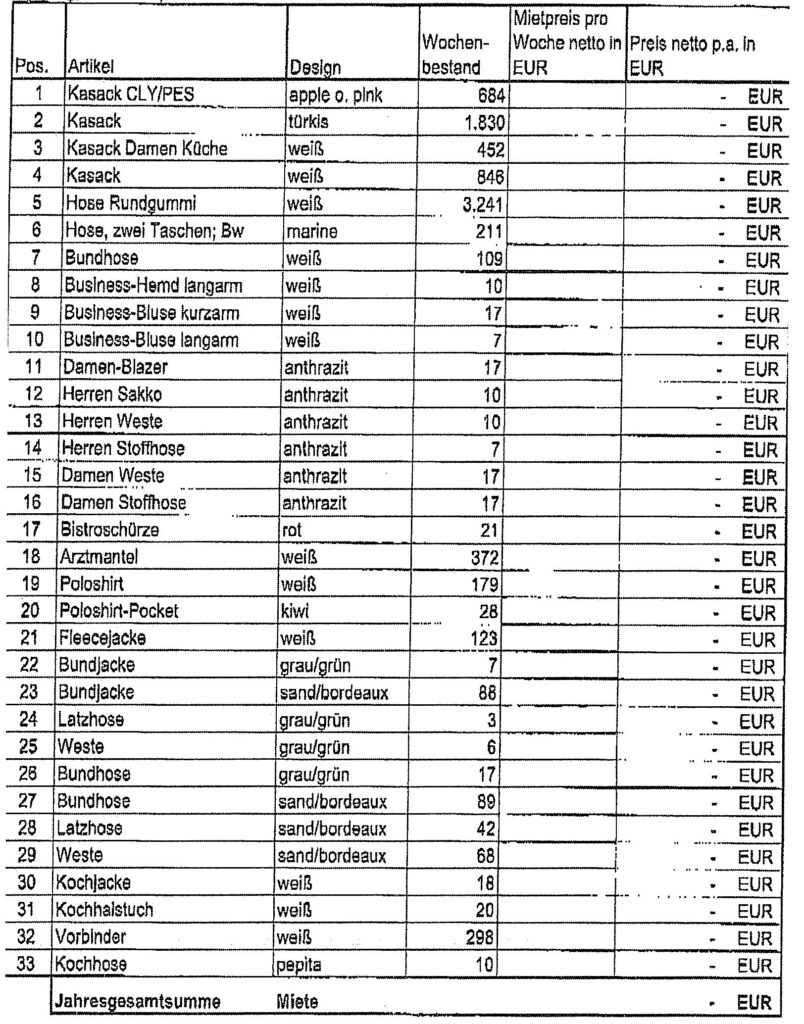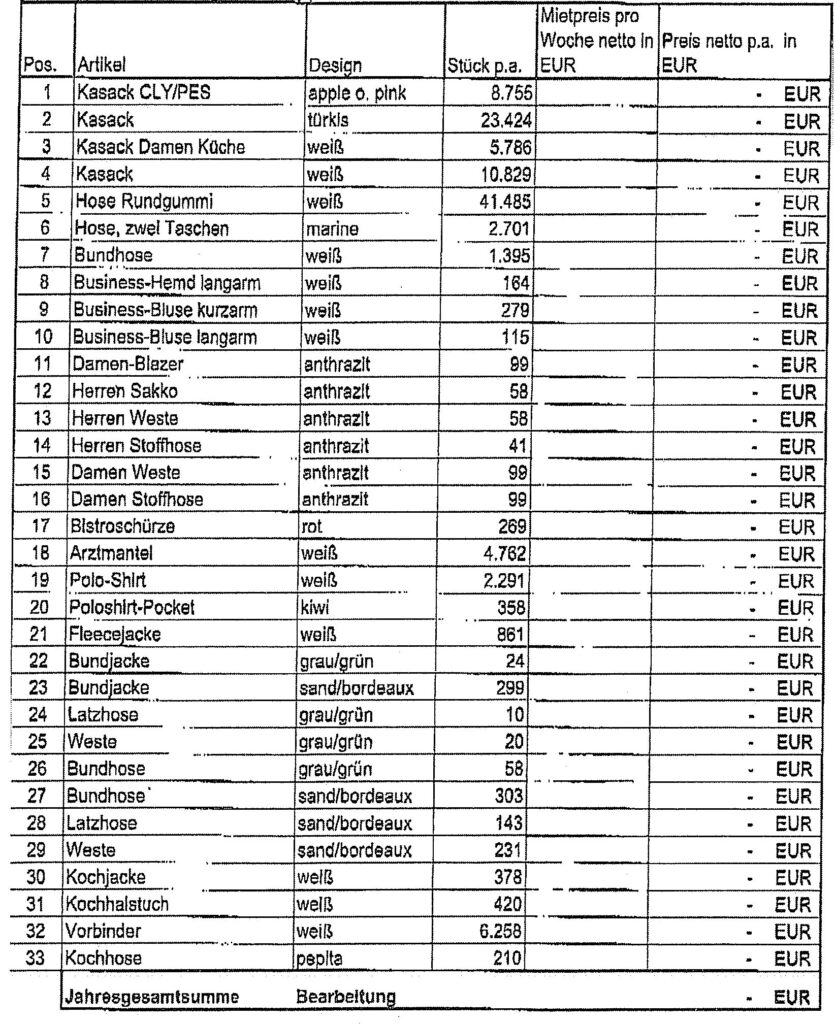vorgestellt von Thomas Ax
Im Vergabeverfahren besteht keine allgemeine Hinweispflicht des Bieters auf Mängel der Vergabeunterlagen, weil der Bieter die Prüfung der Vergabeunterlagen in Vorbereitung seiner Angebotserstellung vor allem unter kalkulatorischen Aspekten vornimmt. Er muss den Auftraggeber nur über von ihm erkannte und offenkundige Mängel der Vergabeunterlagen aufklären, wenn diese dazu führen, dass die Vergabeunterlagen ersichtlich ungeeignet sind, das mit dem Vertrag verfolgte Ziel zu erreichen.
OLG Naumburg, Urteil vom 18.08.2017 – 7 U 17/17
Gründe
A.
Die Klägerin behauptet, der Haftpflichtversicherer des Architektenbüros C.-GmbH (im Folgenden: Versicherungsnehmerin) zu sein. Sie hat für ihre Versicherungsnehmerin Schadensersatz wegen eines Planungsfehlers bei dem Bauvorhaben “Erweiterung des Hochwasserschutzes der Kläranlage W. …” an die Bauherrin gezahlt. Sie nimmt die Beklagte nunmehr aus übergegangenem Recht (§ 86 VVG) im Wege eines Gesamtschuldnerausgleichs in Anspruch.
Die Versicherungsnehmerin der Klägerin hatte im Auftrag des Entwässerungsbetriebs W. … die Vorplanung für das Bauvorhaben “Erweiterung des Hochwasserschutzschutzes der Kläranlage W. …” vorgenommen. Des Weiteren war sie mit den Leistungsphasen 3 bis 9 des § 42 HOAI (Ingenieurbauwerk) und den Leistungsphasen 3 bis 6 des § 49 HOAI (Tragwerkplanung) sowie der Bauüberwachung beauftragt. Sie schaltete ihrerseits die Firma Prof. Dr.-Ing. W. H. und Partner Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abwasserwirtschaft als Nachunternehmerin ein, die die statische Berechnung für die Genehmigungsplanung für die Versicherungsnehmerin der Klägerin übernehmen sollte. Am 31. Juli 2012 überreichte die Nachunternehmerin der Klägerin die statische Berechnung (Anlage K 3, Band I Blatt 25 d.A.), aus der hervorgeht, dass die Spundwand entlang der Kläranlage mit einer Oberkante von 69, 71 m in das vorhandene Gelände eingebracht werden sollte. Bezüglich der Bemessung des Regelprofils der Spundwandbohlen war eine Gesamtlänge von konstruktiv 2,00 m vorgegeben.
Auf der Grundlage dieser statischen Berechnung erstellte die Versicherungsnehmerin der Klägerin daraufhin das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung der Baumaßnahme. Ausweislich des Leistungsverzeichnisses war vorgesehen, dass über die gesamte Länge des Hochwasserschutzdeiches die Spundwandprofile mit der Bezeichnung “Larssen L 600” mit einer Lieferlänge von 2,00 m anzubringen waren (Ziffer 4.6 des Leistungsverzeichnisses). Andere Lieferlängen waren im Leistungsverzeichnis nicht aufgeführt. Unter Ziffer 3.8 des Leistungsverzeichnisses war im Hinblick auf die Vorlage zur Freigabe zur Bauausführung ferner Folgendes bestimmt:
“Der AN hat dem AG/ BOL folgende selbsterarbeitete Unterlagen bzw. Typen- oder Anwendungsblätter zur Freigabe zur Bauausführung rechtzeitig vor Bestellung bzw. vor Einbau vorzulegen. Für diesen Aufwand und damit eventuell entstehende Abstimmungshandlungen kalkuliert der AN
– BE-Plan
– Rammplan
– System Kabeldurchführung
– Spundwandabdeckung
– Korrosionsschutzsystem”
Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses gab zur Erstellung des Rammplanes Folgendes vor:
4.1 Rammplan erstellen
Rammplan für den gesamten Spundwandabschnitt auf der Grundlage der Planungsvorgabe erstellen.
Der Rammplan muss alle für die ordnungsgemäße Herstellung der Spundwand erforderlichen Angaben wie Passmaße, Winkelmaße und Einbautiefen beinhalten. Die Werkplanung ist rechtzeitig vor Ausführungsbeginn dem AG/ BÜ zur Bestätigung zu übergeben. Vor Erstellung des Rammplanes sind die zu querenden Leitungen exakt einzumessen und im Rammplan zu berücksichtigen.”
Wegen der weiteren Einzelheiten nimmt der Senat auf das Leistungsverzeichnis LV 01 Hochwasserschutz Kläranlage Stand 07. Oktober 2014 (Anlage K 11, Band I, Blatt 216 – 237 d.A.) Bezug.
Die Beklagte nahm an dem im Dezember 2012 von der W. eingeleiteten Vergabeverfahren als Bieterin teil. Zur Angebotsabgabe waren ihr von der Vergabestelle neben dem Leistungsverzeichnis die statischen Berechnungen zur Genehmigungsplanung sowie die Detailplanung der Klägerin überreicht worden.
Mit Schreiben vom 12.Februar 2013 fragte die C.-GmbH bei ihrer Subunternehmerin, der Firma Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Ing. W. H. und Partner mbH, nochmals wegen der Plausibilität der Spundwandlänge von 2 m nach, die die Bemessungsdaten erneut ausdrücklich bestätigte.
Am 22. Februar 2013 fand ein Aufklärungsgespräch statt, an dem auch Mitarbeiter der Versicherungsnehmerin der Klägerin teilnahmen und in dem die Vergabestelle mit der Beklagten deren Angebot erörterte. Mit Schreiben vom 25. März 2013 (Anlage B 3, Band I Blatt 120 d.A.) teilte die Versicherungsnehmerin der Klägerin der Beklagten mit, dass der Entwässerungsbetrieb den Bauauftrag an sie ausgelöst und sogleich eine Bauanlaufberatung für den 04.April 2013 anberaumt habe. In dem Schreiben bat die Versicherungsnehmerin der Klägerin die Beklagte ferner, einen aktualisierten Bauablaufplan vorzulegen, der auch die Lieferung und Vorbehandlung der Spundwandelemente berücksichtigt. Außerdem heißt es in diesem Schreiben weiter, dass es für die Bestellung unbedingt erforderlich sei, dass die Beklagte vor Ort die tatsächliche Baulänge selbst ermittele, um Fehlmengen aus evtl. Vermessungsungenauigkeiten auszuschließen. Die Beklagte bestellte daraufhin – ausweislich der Auftragsbestätigung vom 08. Mai 2013 (Anlage K 14, Band I Blatt 242 d.A.) – am 28. März 2013 bei der Firma S. GmbH 1.275 Stück Doppelbohlen vom Typ “Larrsen 600 S 355” mit einer Gesamtlänge von 2,00 m.
Nach der Bauanlaufberatung vom 04. April 2013 verzögerte sich aufgrund der Witterungsverhältnisse der Baubeginn. Mit E-Mail vom 25. Juni 2013 teilte die C.-GmbH der Beklagten mit, dass die Baustelle ab dem 03. Juli 2013 wieder befahrbar sei und die Arbeiten zum Bauvorhaben nunmehr aufgenommen werden könnten. Die Beklagte begann daraufhin am 10. Juli 2013 an der westlichen Seite des Dammes mit den Bauarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Spundwandelemente bereits an die Baustelle geliefert worden. Mit Schreiben vom 12. Juli 2013 (Anlage K 5, Band I Blatt 45 d.A.) meldete sie gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B Bedenken bezüglich der Ausführungsplanung gegenüber dem Entwässerungsbetrieb W. an und beanstandete hierin insbesondere, dass bei Einhaltung der vorgegebenen Höhenangabe die Spundwand bis 1,40 m über OK Gelände rage, was zur Folge habe, dass sie nur maximal 30 cm in den Boden eindringe. Dies sei aus statischer und bautechnischer Hinsicht nicht vertretbar. Das Rammen der Spundbohlen sei unter diesen Gegebenheiten sehr erschwert.
In der sich auf die Bedenkenanzeige der Beklagten anschließenden Baubesprechung vom 17. Juli 2013 legten die Beteiligten fest, dass die Versicherungsnehmerin der Klägerin für den betroffenen Bauabschnitt eine neue Planung nebst Nachberechnung der Statik auf der Basis der Geländehöhen vornehme. Die Nachunternehmerin der Firma C.-GmbH legte daraufhin eine Neuberechnung der Statik vor, die – bezogen auf die Gesamtlänge der Deichkrone – drei Abschnitte mit unterschiedlichen Spundwandlängen auswies, die teilweise bis zu 5 m betrugen. Da sämtliche von den Baubeteiligten erwogenen alternativen Lösungsmöglichkeiten fehlschlugen, unterbreitete die Beklagte am 02. September 2013 auf der Grundlage der geänderten Maße für die Spundwandbohlen ein Nachtragsangebot, das Mehrkosten in Höhe von 264.616, 69 Euro bezifferte (Anlage K 6, Band I Blatt 46 ff d.A.).
Nach Ausführung der Arbeiten legte die Beklagte unter dem 29.Oktober 2014 gegenüber dem Entwässerungsbetrieb W. Schlussrechnung, in der die Mehrkosten für die Nachbestellung der Bohlen mit 251.271, 51 Euro abgerechnet waren. Gemäß dem Prüfbericht der mit der Rechnungsprüfung betrauten P. mbH vom 20. Januar 2015 (Anlage K 7, Band I Blatt 57 ff d.A.) beliefen sich die schadensbedingten Mehrkosten auf brutto 236.354,23 Euro. Der Entwässerungsbetrieb W. nahm im Folgenden die Versicherungsnehmerin der Klägerin auf Schadensersatz in Anspruch und forderte sie mit anwaltlichem Schreiben vom 05. März 2015 zum Ausgleich der Mehrkosten in Höhe von 240.018, 39 Euro auf (Anlage K 8, Band I Blatt 67 d.A.). Die Klägerin leistete daraufhin am 29. April 2015 an den Entwässerungsbetrieb W. einen Teilbetrag in Höhe von 198.000,- Euro. Der Differenzbetrag in Höhe von 42.018,39 Euro ist bislang noch nicht reguliert. Ebenso stehen die von dem geschädigten Auftraggeber geltend gemachten außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.726,48 Euro und eine Zinsforderung in Höhe von beziffert 1.195,49 Euro weiterhin zur Zahlung aus.
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, sie könne von der Beklagten aus von ihrer Versicherungsnehmerin nach § 86 VVG übergeleitetem Recht im Wege des Gesamtschuldnerausgleiches 50 % des von ihr regulierten Schadens erstattet verlangen, denn diese habe sich ebenfalls gegenüber dem Entwässerungsbetrieb der W. schadensersatzpflichtig gemacht, so dass von einer gesamtschuldnerischen Haftung der Versicherungsnehmerin der Klägerin einerseits und der Beklagten andererseits auszugehen sei. So sei der Beklagten vorzuwerfen, dass sie bereits bei Auftragsannahme im Rahmen des Vergabeverfahrens ihren vorvertraglichen Pflichten nicht nachgekommen sei, da sie die Ausschreibungsunterlagen vor Angebotsabgabe nicht ordnungsgemäß geprüft habe. Da der Beklagten neben dem Leistungsverzeichnis auch der Lage- und Höhenplan schon bei Angebotsabgabe vorgelegen habe, hätte sie bei ordnungsgemäßer Prüfung der Vergabeunterlagen feststellen können, dass der werkvertraglich von ihr geschuldete Erfolg mit Spundwandbohlen von 2,00 m Länge nicht zu erbringen gewesen sei. Das unterschiedliche Geländeniveau hätte ihr bei Kontrolle der ausgeschriebenen Mengen und Massen ohne Weiteres auffallen müssen. Das Leistungsverzeichnis habe außerdem eine Baufeldfreimachung und in diesem Zusammenhang die Herstellung eines Roh- und Feinplanums für den Einbau der Spundwand vorgesehen. Hierzu hätte die Beklagte aber die Örtlichkeit bereits vor Abgabe des Angebots untersuchen müssen.
Nach Zuschlagserteilung hätten sich aus den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses, insbesondere aus Ziffer 3.8 und Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses, konkrete vertragliche Prüfpflichten der Beklagten ergeben, die diese bei Auslösung der Bestellung für die Spundwandbohlen aber ersichtlich missachtet habe. So hätte der Rammplan (Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses) bereits bei Bestellung der Spundwände vorliegen müssen. Diesen hätte die Beklagte allerdings korrekterweise erst nach Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Überprüfung der Maße anfertigen können. Der Beklagten sei der Vorwurf zu machen, dass sie sich im Streitfall einfach auf die Fachplanung und statische Berechnung des Statikers verlassen habe, obwohl Umstände vorgelegen hätten, die Mängel der Planung erkennen ließen. Eine allgemeine Überprüfungsverpflichtung bezüglich der Art der Ausführung habe hier bereits nach § 4 Nr.3 VOB/B unmittelbar bei Baubeginn bestanden. Zu den nach Sachlage gebotenen Prüfungen gehörten dabei auch ausreichende tatsächliche Erkundigungen. Hätte die Beklagte die Pläne aber in diesem Sinne einer ausreichenden Kontrolle unterzogen, dann hätte sie noch vor Auslösung der Bestellung erkannt, dass im angrenzenden Nachbarbezirk deutlich längere Spundwandbohlen verbaut worden seien. Sie hat insoweit behauptet, dass bereits aus dem der Beklagten vorliegenden Lageplan vom 17. Juli 2012 hervorgegangen sei, dass ein Regelprofil mit einer Länge von 2 m statisch zu gering bemessen sei. In Abrede genommen hat sie, dass sie die Beklagte im Vorfeld der Baubesprechung vom 04. April 2013 angewiesen habe, die Spundbohlen bereits zu bestellen. Sie ist zudem der Meinung gewesen, dass es sich bei der Mitteilung vom 12. Juli 2013, mit der die Beklagte gegenüber der Auftraggeberin Mängel der Ausführungsplanung gerügt habe, nicht um eine wirksame Bedenkenanzeige nach § 4 Nr.3 VOB/B gehandelt habe, zumal diese gar nicht die unzureichende Dimensionierung der Bohlen zum Gegenstand gehabt habe.
Der Beklagten sei überdies ein eigener Planungsmangel vorzuwerfen. Denn ausweislich des Leistungsverzeichnisses hätten ihr eigene Planungsleistungen oblegen, wie insbesondere aus Ziffern 3.7 und 3.8 sowie 4.1 des Leistungsverzeichnisses im Zusammenhang mit der Rammplanerstellung hervorgehe. Im Zuge der Rammplanerstellung hätte die Beklagte insbesondere auch die konkreten Längen der Spundwandelemente ermitteln und im Rammplan eintragen müssen. Der Rammplan hätte im Übrigen ohne Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten nicht erstellt werden können. Spätestens hierbei hätte der Beklagten aber auffallen müssen, dass die Bemessung der Längen fehlerhaft gewesen sei. Der Rammplan der Beklagten sei mit schadensursächlichen Planungsfehlleistungen behaftet. Hätte sich die Beklagte bei Erstellung des Rammplans vertragsgerecht verhalten, dann wäre es nicht zu einer Falschbestellung der zu kurz dimensionierten Bohlen gekommen.
Die Klägerin hat beantragt,
1.die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 99.000,- Euro nebst Zinsen in Höhe von 5-Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 14. Oktober 2015 zu zahlen;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, die C.-GmbH von der Hälfte sämtlicher Schäden zu befreien, die dieser durch die Inanspruchnahme durch den Entwässerungsbetrieb W. aufgrund der zu kurzen Spundbohlen entstanden sind oder noch entstehen werden.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat bereits die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede genommen und insoweit die Ansicht vertreten, dass aus dem vorgelegten Versicherungsschein nicht eindeutig hervorginge, dass das mit der Bauplanung und Bauüberwachung betraute Architektenbüro C.-GmbH mit der in dem Versicherungsschein als Versicherungsnehmerin bezeichneten C. K. und T. GmbH identisch sei. In der Sache ist sie der Meinung gewesen, dass sie zur Überprüfung der vorliegenden statischen Berechnung der Fachplaner weder als Bieterin bei Angebotsabgabe noch nach Vertragsabschluss im Rahmen der Auftragsausführung verpflichtet gewesen sei. Eine vorvertragliche Prüf- und Hinweispflicht des Bieters sei im Rahmen des Vergabeverfahrens allenfalls dann anzunehmen, wenn diesem Unstimmigkeiten und Fehler der Ausschreibungsunterlagen ohne Weiteres ins Auge springen. Denn im vorvertraglichen Stadium vor Zuschlagserteilung seien die Bieter lediglich zu einer kursorischen Durchsicht und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Plausibilität und technische Umsetzbarkeit verpflichtet. Wollte die Vergabestelle weitergehende Prüfpflichten in den Vergabebedingungen statuieren, würde dies gegen § 7 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A verstoßen. Sie hat behauptet, dass es ihr im Rahmen einer bloß kursorischen, summarischen Prüfung der Ausschreibungsunterlagen indessen nicht möglich gewesen sei, die fehlerhafte Dimensionierung der Spundbohlen zu erkennen. Nach Auftragserteilung habe die Versicherungsnehmerin der Klägerin sie bereits im Vorfeld der Bauanlaufbesprechung vom 04. April 2013 ausdrücklich aufgefordert, die Bestellung der Spundbohlen schnellstmöglich auszulösen, um einen zügigen Bauablauf gewährleisten zu können. Dieser verbindlichen Anweisung habe sie sogleich Folge geleistet und die Spundbohlen nach den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses am 28. März 2013 bestellt. Es treffe nicht zu, dass sie noch vor Auslösung der Bestellung ohne Weiteres hätte erkennen können, dass der werkvertragliche Erfolg mit Spundbohlen von 2 m Länge nicht zu erreichen gewesen sei. Im Hinblick auf die erteilte Weisung habe es die Versicherungsnehmerin der Klägerin letztlich selbst zu verantworten gehabt, dass die Beklagte bereits vor Erstellung des Rammplans sämtliche Bohlen für die Spundwände bestellt habe. Sie ist im Übrigen der Meinung gewesen, dass sich weder aus Ziffer 3.8 des Leistungsverzeichnisses noch aus dessen Ziffer 4.1 im Zusammenhang mit der Erstellung des Rammplans eine Überprüfungspflicht begründen ließe. Sie habe sich vielmehr auf die Richtigkeit der Planungsvorgaben der Fachplaner verlassen dürfen. Eine Überprüfung der Fachplanung wäre nur dann angezeigt gewesen, wenn ihr ein Fehler bei Durchsicht der Unterlagen regelrecht “ins Auge gesprungen” wäre. Ein solch offenkundiger Mangel habe indessen bei Auslösung der Bestellung nicht vorgelegen. Unmittelbar nachdem sie die Fehlerhaftigkeit der Ausführungsplanung bei Baubeginn vor Ort erkannt habe, habe sie der Auftraggeberin ihre Bedenken auch sogleich mit Schreiben vom 12. Juli 2013 mitgeteilt. Auch die allgemeine bauvertragliche Prüf- und Bedenkenhinweispflicht nach § 4 Abs. 3 VOB/B beinhalte lediglich eine kursorische Kontrolle auf Plausibilität und Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses. Eine Verpflichtung, umfassende eigene Ermittlungen anzustellen, treffe den Auftragnehmer in der Regel hingegen nicht. Etwas anderes gelte nur dann, wenn dieser selbst eigene Planungsleistungen vertraglich übernommen habe. Dies sei hier indessen nicht der Fall gewesen. Vielmehr sei der Rammplan gemäß Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses auf der Grundlage der planerischen Vorgaben der Auftraggeberin zu erstellen gewesen und hätte daher keine eigenen Messungen oder sonstigen Ermittlungen der Beklagten erfordert. Der Rammplan diene als Werkplan nämlich lediglich dazu, den Verlauf der herzustellenden Spundwandtrasse zu lokalisieren. Die Beklagte sei deshalb und weil es sich bei der Durchführung geodätischer Leistungen um gesondert ausschreibungs- und vergütungspflichtige Sonderleistungen handele, nicht verpflichtet gewesen, eigene statische Berechnungen anzustellen oder gar die Planungsgrundlage selbst zu ermitteln.
Das Landgericht hat mit dem am 10. März 2017 verkündeten Urteil die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, dass ein Gesamtschuldnerausgleich nach § 426 Abs. 1 BGB schon deshalb ausscheiden müsse, weil sich die Beklagte gegenüber dem Entwässerungsbetrieb W. selbst nicht schadensersatzpflichtig gemacht habe und deshalb für die infolge der Planungsänderungen entstandenen Mehrkosten nicht gesamtschuldnerisch neben der Versicherungsnehmerin der Klägerin einzustehen habe. Der Beklagten habe eine Pflicht zur Überprüfung der statischen Berechnungen der Klägerin und der hieraus resultierenden Angaben des Leistungsverzeichnisses nicht oblegen. Eine Überprüfung auf etwaige Unstimmigkeiten wäre nur dann durchzuführen gewesen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung unumgänglich gewesen wäre oder sich Bedenken gegen die konkrete Art der Ausführung ergeben hätten (§ 4 Abs. 3 VOB/B). Sofern der Auftraggeber allerdings – wie hier – Sonderfachleute für die Ausführungsplanung eingeschaltet habe, könne sich der Bauunternehmer grundsätzlich auf die Richtigkeit der Planung verlassen. Insbesondere statische Berechnungen habe er allenfalls auf offenkundige, sich im Rahmen seiner eigenen Sachkunde aufdrängende Mängel zu überprüfen. Eine vorvertragliche Pflicht, bereits vor Abgabe des Angebots eine aufwändige eigenständige Untersuchung des Geländeniveaus und der Höhe des Hochwasserschutzdeiches vorzunehmen, um die Übereinstimmung mit den Angaben des Leistungsverzeichnisses für den gesamten Streckenabschnitt zu kontrollieren, habe der Beklagten nicht auferlegt werden können. Eine solche vorvertragliche Pflichtenlage hätte überdies der Regelung des § 7 Abs. 1 VOB/A widersprochen, worauf sich die Beklagte zu Recht in diesen Zusammenhang berufen habe. Die Beklagte habe auch im Übrigen über keine besseren Erkenntnisse verfügt, die sie an der Richtigkeit der statischen Berechnung des Fachplaners und der hierauf beruhenden Angaben im Leistungsverzeichnis auf den ersten Blick hätten zweifeln lassen. Insbesondere sei ihr nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen nicht bekannt gewesen, dass bereits zuvor in einem anderen Streckenabschnitt des Deiches längere Spundwandelemente verbaut worden seien. Aber auch nach Zuschlagserteilung hätten ihr insoweit keine Bedenken kommen müssen. Da sie aufgrund der Mitteilung der Versicherungsnehmerin der Klägerin vom 22. März 2012 mit einem zeitnahen Beginn der Bauarbeiten habe rechnen dürfen, sei angesichts der üblichen Produktionsvorlaufzeiten nicht zu beanstanden gewesen, dass sie bereits am 28. März 2013 die Bestellung der Spundwandbohlen ausgelöst habe, auch wenn dem Schreiben vom 22. März 2013 hierzu keine ausdrückliche Weisung zu entnehmen gewesen sei. Da ihr ein Betreten und Befahren des Hochwasserschutzdammes in der Zwischenzeit witterungsbedingt zumindest bis zum 03. Juli 2013 nicht möglich gewesen sei, habe sie den Planungsfehler erst zu einem Zeitpunkt entdecken können, als die zu gering dimensionierten Spundwandelemente bereits an die Baustelle geliefert gewesen seien. Einen Schaden, der darauf zurückzuführen sei, dass die Beklagte ohne Rammplan mit der Ausführung der Arbeiten begonnen habe, habe die Klägerin im Übrigen nicht dargelegt. Es könne daher im Ergebnis offen bleiben, ob der Beklagten jedenfalls bei Gelegenheit der Erstellung des Rammplanes das unterschiedliche Geländeniveau hätte auffallen müssen. Selbst wenn man von einer leicht fahrlässigen Verletzung einer Überprüfungspflicht der Beklagten ausgehen würde, könnte diesem Pflichtenverstoß aber im Gesamtschuldnerinnenausgleich nur ein sehr geringes Gewicht beigemessen werden, so dass er hinter dem weit überwiegenden Verschulden der Versicherungsnehmerin der Klägerin in jedem Fall zurücktreten müsse. Denn auf Seiten der Versicherungsnehmerin der Klägerin müsse ein zweifaches planerisches Versagen in die Abwägung eingestellt werden. Zum einen habe der von der Versicherungsnehmerin der Klägerin beauftragte Sonderfachmann, dessen Handeln sie sich nach § 278 Abs. 1 BGB zurechnen lassen müsse, bei der statischen Berechnung einen massiven Fehler begangen, weil er die Statik offenbar ohne ausreichende Prüfung der örtlichen Verhältnisse erstellt habe. Zum anderen habe die Versicherungsnehmerin der Klägerin diese statische Berechnung ohne eigene kritische Prüfung unbesehen übernommen, obwohl es zuvörderst ihre Pflicht gewesen sei, die Statik auf erkennbare Mängel hin zu kontrollieren. Die Beklagte habe als bauausführendes Unternehmen der Auftraggeberin hingegen keine eigene planerische Leistung geschuldet. Ihr könne allenfalls das vorgeworfen werden, was die Versicherungsnehmerin der Klägerin ihrerseits versäumt habe, nämlich die planerische Fehlleistung nicht sofort aufgedeckt zu haben. Dieses Versäumnis werde hingegen durch das weit überwiegende Verschulden der Versicherungsnehmerin der Klägerin verdrängt.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der diese ihre erstinstanzlichen Klageanträge weiterverfolgt.
Die Klägerin rügt mit ihrer Berufung, dass das Landgericht ihr Vorbringen zum Pflichtenkatalog der Beklagten und zur Erkennbarkeit des Planungsmangels nebst den Beweisantritten verfahrensfehlerhaft übergangen und eine eigene Prüfpflicht der Beklagten bezüglich der statischen Berechnung insoweit verneint habe. Das Landgericht habe verkannt, dass die Beklagte bereits vor Angebotsabgabe im Rahmen des Vergabeverfahrens die Pflicht getroffen habe, die Ausschreibungsunterlagen einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Ausweislich des Leistungsverzeichnisses sei sie zur örtlichen Überprüfung der Mengen und Massen angehalten gewesen. Hierbei hätte ihr aber das unterschiedliche Geländeniveau ohne Weiteres auffallen müssen. Aus dem Protokoll zum Aufklärungsgespräch vom 22. Februar 2013 könne ebenfalls hergeleitet werden, dass die Beklagte um die örtlichen Begebenheiten der Baustelle vor Angebotsabgabe gewusst haben müsse. Nicht nachvollziehbar sei in diesem Zusammenhang, dass das Landgericht ihr Beweisangebot auf Einholung eines Sachverständigengutachtens unberücksichtigt gelassen habe. Das Landgericht habe sich insoweit eigenen Sachverstand angemaßt, den es aber tatsächlich nicht besitze. Nach Zuschlagserteilung habe der Beklagten sodann aus dem Bauvertrag die vertragliche Verpflichtung oblegen, die Massen- und Mengenangaben des Leistungsverzeichnisses sowie die zugrundeliegenden statischen Berechnungen zu überprüfen. Dabei ist sie nach wie vor der Ansicht, dass sich die vertraglichen Prüfpflichten insbesondere aus Ziffer 3.8 und 4.1 des Leistungsverzeichnisses entnehmen ließen. Die Beklagte hätte insbesondere für die Erstellung des Rammplanes das Geländeniveau kontrollieren müssen und dabei feststellen können, dass die 2,00 m Spundwandbohlen den werkvertraglichen Erfolg nicht erbringen könnten. Diese Prüfung hätte sie vor Auslösung der Bestellung der Spundwandbohlen vornehmen müssen.
Soweit das Landgericht in Bezug auf die Erstellung des Rammplans einen ausreichenden Vortrag zu dem Schaden vermisst habe, hätte es hierzu zunächst einen richterlichen Hinweis erteilen müssen. Zu beanstanden sei überdies auch insoweit, dass sich das Landgericht im Hinblick auf die Erkennbarkeit des Planungsfehlers eigene Sachkunde angemaßt habe, die ihm nicht zustünde. Es hätte vielmehr dem angebotenen Sachverständigenbeweis nachgehen müssen. Das Landgericht habe sich in dem angefochtenen Urteil auch nicht im Einzelnen damit befasst, dass sich aus verschiedenen Positionen des Leistungsverzeichnisses Prüfplichten des Auftragnehmers herleiten ließen. Ihr diesbezügliches Vorbringen zu den aus dem Leistungsverzeichnis hervorgehenden Vertragspflichten der Beklagten habe in dem angefochtenen Urteil überhaupt keine Berücksichtigung gefunden. Ausweislich des Leistungsverzeichnisses habe die Beklagte vor der Erstellung der Spundwand und der Bestellung deren Bauteile diverse Vorarbeiten zu erledigen gehabt, bei denen ihr indessen das unterschiedliche Geländeniveau (Gefälle der Deichkrone) ohne Weiteres hätte auffallen müssen. Sie hält überdies an ihrer Behauptung fest, dass der Beklagten keineswegs die Weisung erteilt worden sei, die Bestellung der Spundwände noch im März 2013 auszulösen. Aus der E-Mail vom 22. März 2013 gehe vielmehr hervor, dass die Beklagte die Länge der Spundwandbohlen vor Ort selbst zu überprüfen habe. Die Beklagte habe die Spundwände demgegenüber ohne jeden vernünftigen Grund bereits so frühzeitig bestellt, ohne die örtlichen Verhältnisse zuvor überprüft zu haben. Soweit das Landgericht die frühzeitige Bestellung angesichts der Produktionsvorlaufzeiten für naheliegend erachtet habe, beruhe das Urteil auf gänzlich ungesicherten Annahmen. Sie ist zudem der Ansicht, dass der Beklagten nach § 4 Nr.3 VOB/B die Pflicht oblegen habe, die Vertragsunterlagen zu überprüfen und im unmittelbaren Nachgang hierzu Bedenken anzumelden. Hierzu hätten unter Umständen auch tatsächliche Erkundigungen angestellt werden müssen. Auf die Fachplanung der Sonderfachleute habe sie sich hingegen nicht verlassen dürfen, sofern – wie hier – Umstände vorliegen, die Planungsmängel erkennbar werden ließen. Bereits ein einfacher Abgleich der statischen Berechnungen mit dem der Beklagten vorliegenden Lageplan hätte ergeben, dass das Regelprofil der Spundwandbohlen mit 2 m Länge zu gering bemessen sei, da dies allenfalls im östlichen Deichabschnitt korrekt gewesen sei, die örtlichen Gegebenheiten sich jedoch in den anderen Baubereichen höhenmäßig verändert hätten. Auch anhand des Ausführungsplans der Versicherungsnehmerin der Klägerin A 04, der zum 09. April 2013 übergeben werden musste, hätte die Beklagte ohne Weiteres erkennen können, dass die Länge der Bohlen mit 2 m für die Baumaßnahme unzureichend sein müsse. Auch wenn die Bestellung bei Vorlage der Ausführungsplanung schon ausgelöst gewesen sei, hätte die Beklagte aber den Auftrag zu diesem Zeitpunkt noch unproblematisch korrigieren können.
Sie meint zudem, dass der Beklagten aber auch ein eigener schadensursächlicher Planungsmangel vorzuwerfen sei. Denn im Zusammenhang mit der Erstellung des Rammplanes, der aus bautechnischen Gründen zeitlich vor der Bestellung der Spundwandelemente habe vorliegen müssen, habe die Beklagte alle für die Herstellung der Spundwände maßgeblichen Produktionsdaten berücksichtigen müssen. Für die Erstellung des Rammplanes sei es überdies unabdingbar gewesen, die Örtlichkeit in Augenschein zu nehmen. Die Beklagte habe insoweit eine eigene Planungsleistung erbringen müssen und dementsprechend selbst Planungsverantwortung getragen. Im Hinblick auf die eigenen Planungsversäumnisse der Beklagten und die ihr ebenfalls vorzuwerfende mangelnde Überprüfung der Vertragsunterlagen hält die Klägerin eine Eigenhaftungsquote der Beklagten von 50 % für angemessen und sachgerecht. Dass die Beklagte trotz offensichtlicher Erkennbarkeit des Planungsmangels diesen der Auftraggeberin nicht angezeigt habe, stelle eine erhebliche Verletzung der Prüf- und Bedenkenanmeldungspflicht aus § 4 Nr.3 VOB/B dar, die eine Haftungsteilung rechtfertige. Die Regelung des § 7 VOB/ A stünde dem Klageanspruch nicht entgegen.
Die Klägerin beantragt,
das am 10. März 2017 verkündete Einzelrichterurteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau abzuändern und
1. die Beklagte zu verurteilen, an sie 99.000,- Euro nebst Zinsen in Höhe von 5-Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 14. Oktober 2015 zu zahlen;
2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, die C.-GmbH von der Hälfte sämtlicher Schäden zu befreien, die dieser aus der Inanspruchnahme durch den Entwässerungsbetrieb W. aufgrund der zu kurzen Spundbohlen entstanden sind oder noch entstehen;
sowie hilfsweise
das Einzelrichterurteil der 2. Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau vom 10. März 2017 aufzuheben und den Rechtsstreit an das Landgericht Dessau-Roßlau zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klägerin zurückzuweisen.
Sie rügt bereits die Unzulässigkeit der Berufung und meint, dass die Klägerin ihre Berufung schon nicht wirksam innerhalb der Berufungsfrist des § 517 ZPO eingelegt habe, denn in dem Berufungsschriftsatz vom 11. April 2017 sei sie nicht als Rechtsmittelführerin, sondern als Berufungsbeklagte bezeichnet. Außerdem sei darin formuliert, dass die Berufung im Auftrag der Beklagten eingelegt werde. Die fehlerhafte Bezeichnung des Rechtsmittelführers müsse aber zur Unzulässigkeit der Berufung führen.
In der Sache verteidigt sie das angefochtene Urteil des Landgerichts unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens. Sie hält insbesondere an ihrer Ansicht fest, dass ihr weder vor Angebotsabgabe noch nach Zuschlagserteilung die Verpflichtung oblegen habe, die Planungen der C.-GmbH einer eigenen Überprüfung zu unterziehen. Im vorvertraglichen Stadium sei sie allenfalls gehalten gewesen, eine Durchsicht der Ausschreibungsunterlagen auf ins Auge springende Lücken oder Unklarheiten vorzunehmen, keinesfalls könne man einem Bieter hingegen die Aufgabe einer zweiten Ausschreibungsinstanz übertragen. Aber auch aus dem Leistungsverzeichnis, das sie Klägerin im Übrigen verspätet in den Prozess eingeführt habe, lasse sich keine vorvertragliche Pflicht der Bieter herleiten, sämtliche Massen und Mengenangaben zu kontrollieren. Sie meint, dass ihr auch nach Zuschlagserteilung keine vertragliche Prüfungs- und Hinweispflicht im Hinblick auf die inhaltliche Richtigkeit der statischen Berechnung oblegen habe. Eine Pflicht zu eigenen Planungsleistungen oder technischen Untersuchungen habe ebenfalls nach dem Bauvertrag nicht bestanden. Soweit in der allgemeinen Leistungsbeschreibung des Leistungsverzeichnisses hingegen bestimmt sei, dass “sämtliche angegebenen Mengen und Massen örtlich zu kontrollieren” seien, sei diese Regelung inhaltlich unwirksam, was auch auf die Durchführung des später zustande gekommenen Bauvertrages durchschlagen müsse. Sie meint, dass sich aus den Ziffern 3.8 und 4.1 des Leistungsverzeichnisses ebenfalls keine Prüfpflichten für den Auftragnehmer herleiten ließen, denn diese Positionen würden auf die statische Berechnung als verbindliche vertragliche Vorgabe Bezug nehmen und damit eigene Vermessungsarbeiten der Beklagten zugleich ausschließen. Sie ist überdies der Ansicht, dass ein etwaiger eigener Mithaftungsanteil durch das weit überwiegende Planungsverschulden der Versicherungsnehmerin der Klägerin verdrängt würde und deshalb zurücktreten müsse.
Wegen des weitergehenden Sachvortrages der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen
B.
I.
Die Zulässigkeit der Berufung der Klägerin begegnet – entgegen der Ansicht der Beklagten – keinen durchgreifenden Bedenken. Insbesondere hat die Klägerin ihr Rechtsmittel – trotz falscher Parteibezeichnung – mit Berufungsschriftsatz vom 11. April 2017 in rechter Form nach §§ 517, 519 ZPO eingelegt.
Gemäß § 519 Abs. 2 ZPO muss die Berufungsschrift die Bezeichnung des angefochtenen Urteils und die Erklärung enthalten, dass hiergegen Berufung eingelegt werde. Diesem Erfordernis wird nach der Rechtsprechung nur dann genügt, wenn bei Einlegung des Rechtsmittels aus der Rechtsmittelschrift selbst oder in Verbindung mit anderen Unterlagen oder Umständen sowohl der Rechtsmittelkläger als auch der Rechtsmittelbeklagte erkennbar sind oder zumindest bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist erkennbar werden (vgl. BGH VersR 1985, 570 m.w.N.; BGH MDR 1996, 92). Dabei sind an die eindeutige Bezeichnung des Rechtsmittelführers, um die es vorliegend geht, strenge Anforderungen zu stellen. Jeder Zweifel an der Person des Rechtsmittelklägers muss nach verständiger Würdigung des gesamten Vorgangs der Rechtsmitteleinlegung ausgeschlossen sein (vgl. BGH MDR 1996, 92; BGH NJW 1999, 1554). Dies bedeutet hingegen nicht, dass die erforderliche Klarheit über die Person des Berufungsklägers ausschließlich durch dessen ausdrückliche Bezeichnung in der Berufungsschrift selbst zu erzielen wäre. Sie kann vielmehr auch im Wege der Auslegung unter ergänzender Heranziehung weiter vorliegender Unterlagen gewonnen werden (vgl. BGH MDR 1996, 92 m.w.N.; BGH NJW 1998, 3499; BGH NJW 1999, 1554). Insoweit sind, wie auch sonst bei der Auslegung von Prozesserklärungen, alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen, die dem Gericht bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bekannt sind und dem Rechtsmittelgegner zugänglich waren (vgl. BGH NJW 19991554). Die Auslegung von Prozesserklärungen hat den Willen der Erklärenden zu beachten, wie er den äußerlich in Erscheinung getretenen Umständen üblicherweise zu entnehmen ist. Dabei bestehen keine Bedenken, auch Tatbestand und Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils für die Auslegung der Berufungsschrift heranzuziehen, sofern – wie im Streitfall – eine vollständige Abschrift des Urteils für das Berufungsgericht nach § 519 Abs. 3 ZPO beigefügt ist (vgl. BGH NJW 1999, 1554).
Die an den Inhalt der Berufungsschrift zu stellenden formellen Anforderungen sind hier indessen erfüllt.
Im Rubrum des Schriftsatzes ist die Klägerin zwar fehlerhaft als Berufungsbeklagte bezeichnet worden. Auch ist irrtümlich formuliert worden, dass die Berufung im Auftrag der Beklagten eingelegt werde. Dass es sich hierbei um einen offensichtliche Unrichtigkeit handelt und tatsächlich die Klägerin als Berufungsführerin das Rechtsmittel gegen das am 10. März 2016 verkündete Urteil des Landgerichts einlegen will, hat sich hier hingegen im Wege einer verständigen Auslegung ohne Weiteres aus den Gesamtzusammenhängen des Schriftsatzes herleiten lassen. Die Berufungsschrift ist von den erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten der Klägerin eingereicht worden. Dem Eingang des Schriftsatzes hat sich dabei entnehmen lassen, dass die Rechtsanwälte Sch., Kp. und L., die die Berufungsschrift verfasst haben, tatsächlich die Prozessvertreter der Klägerin und nicht der Beklagten sind. Der Berufungsschrift war zudem eine Abschrift des angefochtenen Urteils entsprechend § 519 Abs. 3 ZPO beigefügt, aus dessen Rubrum ebenfalls hervorgeht, dass die Rechtsanwälte Sch., Kp. und L. in erster Instanz für die Klägerin aufgetreten und deren Interessen wahrgenommen haben. Außerdem hat sich dem klageabweisenden Urteilstenor der Urteilsabschrift entnehmen lassen, dass die Klägerin und nicht etwa die Beklagte durch die Entscheidung des Landgerichts beschwert worden ist. Die konkreten Umstände des Falls lassen danach aber keine vernünftigen Zweifel an dem wirklich Gewollten aufkommen. Aus objektiv verständiger Sicht konnte aus den Gesamtumständen vielmehr unproblematisch geschlossen werden, dass den Prozessvertretern der Klägerin hinsichtlich der Bezeichnung der Parteien in der Berufungsschrift versehentlich ein offenbarer Schreibfehler unterlaufen war und sie die Berufung tatsächlich im Auftrag ihrer durch das erstinstanzliche Urteil beschwerten Mandantin, der Klägerin, einlegen wollten.
II.
Die insoweit zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin bleibt in der Sache indessen ohne Erfolg.
Das angefochtene Urteil des Landgerichts beruht weder auf einer Rechtsverletzung (§ 546 ZPO), noch rechtfertigen die nach § 529 Abs. 1 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine abweichende Entscheidung des Senats.
Erster Teil: Klageantrag zu 1):
Wie das Landgericht zutreffend festgestellte hat, kann die Klägerin die Beklagte nicht aus nach § 86 VVG übergeleitetem Recht auf Zahlung von 99.000,- Euro im Wege des Gesamtschuldnerinnenausgleichs nach § 426 Abs. 1 BGB in Anspruch nehmen.
1. Die Klägerin ist nach § 86 VVG aktivlegitimiert. Sie hat durch Vorlage des Versicherungsscheins (Anlage K 2, Band I Blatt 24 d.A.) hinreichend belegt, dass die C.-GmbH, die für den Entwässerungsbetrieb W. die Planungsleistungen erbracht hat, bei ihr mit einer Deckungssumme über 2.000.000,00 Euro für Sachschäden haftpflichtversichert ist. Der Senat hat keine Zweifel, dass die C.-GmbH mit der im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsnehmerin, der C. K. und T. GmbH identisch ist. Für eine entgegenstehende Annahme bestehen keine Anhaltspunkte. Aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Hannover (HRB 110741) geht hervor, dass die Gesellschafterversammlung der Klägerin am 10. Dezember 2010 eine Änderung der Firma in C.-GmbH beschlossen hatte, was am 18. Januar 2011 im Handelsregister eingetragen wurde. Das Landgericht hat überdies im Tatbestand seines Urteils mit Bindungswirkung nach § 314 ZPO als unstreitige Tatsache festgestellt, dass die Klägerin als Versicherer der C.-GmbH an den geschädigten Entwässerungsbetrieb W. wegen Planungsversäumnisse ihrer Versicherungsnehmerin eine Versicherleistung in Höhe von 198.000,- Euro erbracht hat. In diesem Umfang ist ein etwaiger Regressanspruch ihrer Versicherungsnehmerin aber auf sie nach § 86 Abs. 1 VVG übergegangen.
2. Der Ausgleichsanspruch nach § 426 Abs. 1 BGB entsteht nach gefestigter Rechtsprechung bereits in dem Augenblick, in dem die mehreren Ersatzpflichtigen dem Geschädigten gegenüber ersatzpflichtig werden, also unmittelbar mit Begründung der Gesamtschuld (vgl. BGHZ 181, 310; BGHZ 11, 170, 174; BGHZ 114, 117, 122; BGH BauR 1994, 621; BGH BauR 2008, 381). Eine solche Gesamtschuldnerschaft kann dabei insbesondere auch zwischen einem Bauunternehmer und dem planenden sowie die Bauaufsicht führenden Architekten wegen desselben Mangels des Bauwerkes im Verhältnis zum Bauherrn begründet werden (vgl. BGHZ 43, 227; BGHZ 51, 275; BGH BauR 1989, 97; BGH BauR 2007, 2083; Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 6. Teil, Rdn. 90; Werner / Frechen in Werner / Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 2482).
Ein Innenausgleich nach § 426 Abs. 1 BGB setzt dabei voraus, dass die Beklagte dem Entwässerungsbetrieb der W. wegen der falsch dimensionierten Spundwandbohlenlänge gesamtschuldnerisch (§§ 421, 425 BGB) neben der C.-GmbH auf Ersatz der Mehrkosten haftet. Dem Entwässerungsbetrieb der W. müsste mithin auch gegen die Beklagte ein Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten wegen der Neubestellung der Spundwandbohlen zustehen. Dies trifft indessen im Streitfall unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.
a) Die Klägerin kann einen solchen Schadensersatzanspruch insbesondere nicht auf §§ 280 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB wegen einer schuldhaften Verletzung vorvertraglicher Prüf- und Hinweispflichten der Beklagten vor Abgabe des Angebots stützen.
aa) Mit Beteiligung der Beklagten im Vergabeverfahren ist allerdings bereits ein vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des § 311 2 Nr. 1 BGB zwischen ihr und der Vergabestelle entstanden, aus dem wechselseitige Rücksichtnahmepflichten sowie die Verpflichtung zur Einhaltung der sich aus der VOB/A ergebenden Regeln resultieren (vgl. BGHZ 173, 33; OLG Hamm VergabeR 2015, 812; OLG München VergabeR 2013, 729; OLG Stuttgart VergabeR 2011, 144; Kniffka in Koebele, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., Teil 6, Rdn. 48).
bb) Dass die Beklagte in haftungsrechtlich relevanter Weise solche vorvertraglichen Rücksichtnahmepflichten nach § 241 2 BGB verletzt hat, vermag der Senat indessen nicht festzustellen.
(1) In welchem Umfang dem Bieter bei öffentlichen Ausschreibungen über die Rügepflicht im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren nach § 160 Abs. 3 GWB hinaus vorvertragliche Hinweispflichten obliegen sollen, lässt sich nicht einfach beantworten (vgl. OLG München VergabeR 2013, 729). Eine generelle Hinweis- und Aufklärungsverpflichtung des Bieters besteht im Ausschreibungs- und Angebotsstadium jedenfalls nicht, da der Bieter die Prüfung der Verdingungsunterlagen in Vorbereitung seines eigenen Angebots nur unter kalkulatorischen Aspekten vornimmt (vgl. OLG Celle, Urteil vom 31. Januar 2017, 14 U 200/15 zitiert nach juris).
Aus dem allgemeinen Gebot zu korrektem Verhalten und Rücksichtnahme bei den Vertragsverhandlungen kann eine vorvertragliche Prüfungs- und Hinweispflicht des Bieters indessen dann unter Umständen hergeleitet werden, wenn die Verdingungsunterlagen erkanntermaßen evident fehlerhaft sind. Über die sich aus den Bewerbungsbedingungen ergebende allgemeine Pflicht, auf Unklarheiten und etwaige Plausibilitätsdefizite hinzuweisen (vgl. hierzu: BGH MDR 1988, 43; OLG Naumburg, Urteil vom 22. Februar 2013, 12 U 120/12), wird die Pflicht deshalb nicht hinausgehen. Anderenfalls würde das Gefüge der widerstreitenden Interessen zwischen den potentiellen Vertragspartnern zu sehr verschoben (vgl. OLG München VergabeR 2013, 729).
Ein Bieter ist gemäß §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB mithin nur dann verpflichtet, auf Mängel der Ausschreibungsunterlagen hinzuweisen, wenn er die Ungeeignetheit der Ausschreibung vor Vertragsabschluss positiv erkennt (vgl. OLG Celle, Urteil vom 31. Januar 2017, 14 U 200/15; Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 04. Aufl., 6. Teil, Rdn. 48) bzw. etwaige Unstimmigkeiten und Lücken des Leistungsverzeichnisses klar auf der Hand liegen. Über die von ihm erkannten und offenkundigen Mängel der Vergabeunterlagen muss er den Auftraggeber dann aufklären, wenn diese ersichtlich ungeeignet sind, das mit dem Vertrag verfolgte Ziel zu erreichen.
Was dem Bieter nach der jeweiligen Sachlage im Übrigen bereits im Stadium der Vertragsverhandlungen abverlangt werden kann, hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab (vgl. BGH MDR 1988, 43).
(2) Dass die Beklagte den Fehler der statischen Berechnung der Spundwandprofile bereits bei Durchsicht der Vergabeunterlagen vor Abgabe des Angebots tatsächlich erkannt hat, behauptet die Klägerin schon nicht mit der gebotenen Substanz. Für eine positive Kenntnis der Beklagten von dem Planungs- bzw. Berechnungsmangel liegen auch nach Lage der Akten keine Anhaltspunkte vor.
Es ist aber auch nichts dafür ersichtlich, dass die Beklagte den bei den Längenangaben der Spundwandbohlen aufgetretenen statischen Berechnungsfehler bei sorgfältigem Studium der Vergabeunterlagen auf ersten Blick hätte erkennen müssen. Der Beklagten lagen hier zwar unstreitig bereits bei Abgabe des Angebots das von der Versicherungsnehmerin der Klägerin erstellte Leistungsverzeichnis und die diesem zugrunde liegende statische Berechnung vor. Im Stadium der Vertragsanbahnung war sie indessen keineswegs gehalten, die von einem Sonderfachmann für die Ausschreibung eigens erstellte Statik einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen (vgl. ebenso: BGH MDR 1988, 43). Entgegen der Ansicht der Klägerin kann von dem Bieter nicht als vorvertragliche Verpflichtung abverlangt werden, die Ausschreibung auf Planungsmängel hin inhaltlich zu untersuchen und hierfür aufwändige eigene Recherchen anzustellen (vgl. Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil, Rdn. 48).
Dass die Problematik einer dem unterschiedlichen Geländeniveau Rechnung tragenden Dimensionierung der Spundwandbohlen durch bloße Einsichtnahme in die Vertragsunterlagen wie das Leistungsverzeichnis nicht ohne Weiteres hat erkannt werden können, räumt letztlich auch die Klägerin ein. Wie das Landgericht in dem angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt hat, musste die Beklagte zur Erstellung ihres Angebots auch keineswegs eigene Vermessungen des Geländeniveaus sowie der Höhe des Hochwasserschutzdeiches über den gesamten Streckenabschnitt vor Ort vornehmen, um zu kontrollieren, ob das im Leistungsverzeichnis ausgewiesene Spundwandprofil zutreffend ist. Der Senat vermag der Klägerin insbesondere nicht darin zu folgen, dass es zu den Pflichten eines Unternehmers zähle, vor Abgabe des Angebots von den örtlichen Verhältnissen Kenntnis zu nehmen und die in dem Leistungsverzeichnis angegebenen Massen anhand eigener Vermessungen zu über prüfen. Denn die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ist alleinige Sache des Auftraggebers. Er hat, soweit erforderlich, mit finanziellem Aufwand eigene Untersuchungen anzustellen, um eine klare Übersicht über die ihm noch nicht bekannten Umstände zu erhalten und um Gegebenheiten festzustellen, die für eine Preisermittlung der Bieter von Bedeutung sind (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 07. Juni 1985, 6 U 148/84 zitiert nach juris; OLG Hamm, Urteil vom 14. Oktober 2016, 12 U 67/15).
(3) Soweit unter Titel 1 “Allgemeine Vorbemerkungen” des Leistungsverzeichnisses hingegen vorgesehen ist, dass der Bieter mit der Abgabe des Angebotes bestätige, sich mit den örtlichen Gegebenheiten durch eine Ortsbesichtigung vertraut gemacht zu haben, rechtfertigt diese Klausel des Leistungsverzeichnisses keine abweichende Beurteilung. Zum einen ist damit noch nicht besagt, dass die Beklagte bei einer Ortsbesichtigung auch eine eigene Vermessung des Geländeniveaus hat vornehmen sollen. Dass sie den Fehler der statischen Berechnung schon bei einer ersten Ortbesichtigung der Baustelle auf ersten Blick ohne weiteres hätte erkennen können, ist hingegen nicht ersichtlich.
Zum anderen würde die Auferlegung einer solchen Verpflichtung vor Angebotsabgabe auf den Bieter aber auch der vergaberechtlichen Vorschrift des § 7 Abs. 1 VOB/A widerstreiten. Denn danach muss allein der Ausschreibungstext den Bieter in die Lage versetzen, ohne einen vorherigen Ortstermin ein umfassendes Angebot abzugeben (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 14. Oktober 2016, 12 U 67/15 Rdn. 17 zitiert nach juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 07. Juni 1985, 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245 zitiert nach juris).
Die hier in Rede stehende Klausel im Ausschreibungstext vermag einer Inhaltskontrolle nach §§ 307 Abs. 1, 310 Abs. 1 BGB insoweit nicht standzuhalten. Es handelt sich nämlich um eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, indem er den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt. Die vorliegende Tatsachenbestätigung bewirkt eine für den Unternehmer nachteilige Verschiebung der Beweislast. Erleidet der Unternehmer nämlich im Falle unzureichender Beschreibung der Örtlichkeiten in den Ausschreibungsunterlagen einen Schaden, weil er bestimmte Umstände, die bei Kenntnis der örtlichen Verhältnisse hätten berücksichtigt werden können, in seine Kalkulation nicht einfließen lässt, führt die Klausel dazu, dass er nunmehr selbst beweisen muss, ihn treffe kein Mitverschulden, weil ihm entgegen seiner Erklärung die örtlichen Verhältnisse unbekannt gewesen seien (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 07. Juni 1985, 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245 zitiert nach juris). Die Klausel benachteiligt auch den Unternehmer mit Kaufmannseigenschaft unbillig, weil die Beweislast grundlegende, oft prozessentscheidende Bedeutung hat. Vorliegend kommt hinzu, dass die Tragweite der Klausel, anders als bei Freizeichnungen oder der Bestätigung, eine Ware mangelfrei erhalten zu haben, auch im kaufmännischen Geschäftsverkehr nicht ohne Weiteres in ihrer Bedeutung erkannt wird (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 07. Juni 1985, 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245 zitiert nach juris).
Eine Verletzung vorvertraglicher Rücksichtnahmepflichten nach §§ 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB kann nach alledem nicht angenommen werden kann, da nichts dafür ersichtlich ist, dass die Beklagte die Fehlerhaftigkeit der Ausschreibung – ebenso wie der Auftraggeber – vor Vertragsschluss erkannt hat. Es ist im Übrigen weder dargetan noch ersichtlich, dass die Beklagte schon zur Zeit der Angebotsabgabe über anderweitige, bessere Erkenntnisse verfügte, die sie an der Richtigkeit der statischen Berechnung der Versicherungsnehmerin der Klägerin hätten zweifeln lassen müssen.
b) Aber auch nach Erteilung des Bauauftrages hat sich die Beklagte nicht gegenüber dem Entwässerungsbetrieb W. wegen der Bestellung zu gering dimensionierter Spundwandbohlen in Höhe von 50 % der Mehrkosten aus § 4 7 S. 2 VOB/B schadensersatzpflichtig gemacht.
aa) Zwischen der Beklagten und dem Entwässerungsbetrieb der W. ist mit Zuschlagserteilung ein Bauvertrag über die Errichtung einer Hochwasserschutzanlage an der Kläranlage W. auf der Basis des Leistungsangebotes der Beklagten rechtswirksam zustande gekommen. Gegenstand der vertraglichen Einigung der Parteien bildet dabei das von der Versicherungsnehmerin der Klägerin gefertigte Leistungsverzeichnis, auf dessen Grundlage die Beklagte das bezuschlagte Angebot der Auftraggeberin im Vergabeverfahren unterbreitet hatte.
In dem Bauvertrag hatten die Vertragsparteien unstreitig die Geltung der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) vereinbart.
bb) Da die Länge der bestellten Spundwandbohlen noch vor deren Einbau und damit bereits während der Bauausführung beanstandet wurde und eine Neubestellung der Spundwandelemente dementsprechend vor Abnahme des Bauwerkes veranlasst werden musste, richtet sich der Schadensersatzanspruch der Auftraggeberin nach § 4 7 S. 2 VOB/B. Die Vorschrift des § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/ B gewährt insoweit Ersatz des Schadens, der bei weiterbestehenden Vertrag trotz Mängelbeseitigung verbleibt.
Die anspruchsbegründenden Voraussetzungen für eine Schadensersatzhaftung der Beklagten nach § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/B liegen hier indessen nicht vor.
(1) Die von der Beklagten am 28. März 2013 bestellten Spundwandbohlen entsprachen den technischen Anforderungen für einen sicheren Hochwasserschutz zwar unstreitig nicht, weil das Längenmaß der Spundwandelemente nicht dem unterschiedlichen Geländeniveau Rechnung trug und deshalb im Hinblick auf den gesamten Deichverlauf zu gering bemessen war. Die fehlerhafte Angabe des Längenmaßes im Leistungsverzeichnis beruht indessen nicht auf einer Fehlplanung der Beklagten. Diese ist bei Bestellung der Bohlen vielmehr lediglich den Vorgaben aus dem Leistungsverzeichnis zur Spundwandlänge gefolgt. Die genauen Parameter, die die Spundwandbohlen aufweisen sollten, waren ihr in dem Leistungsverzeichnis nämlich konkret vorgeschrieben worden; eine Auswahlmöglichkeit hatte sie nicht. Die in dem Leistungsverzeichnis vorgegebenen Baumaße der Spundwandbohlen sind dabei unbestritten auf die durch das Ingenieurbüro Prof. H. und Partner Ingenieurgesellschaft ausgeführte Statik und die Ausführungsplanung der Versicherungsnehmerin der Klägerin zurückzuführen und damit deren planerischen Verantwortungsbereich zuzuordnen.
(2) Soweit die Klägerin der Beklagten gleichwohl eigene Planungsversäumnisse im Zusammenhang mit der Erstellung des Rammplans vorwirft und insoweit behauptet, dass diese nach Ziffern 3.8 und 4.1 des Leistungsverzeichnisses einen schadensursächlichen Planungsmangel begangen habe, da der Rammplan aus bautechnischen Gründen zwingend vor Auslösung der Bestellung der Spundwandbohlen hätte erstellt werden müssen und alle für die Herstellung der Spundwand erforderlichen Angaben hätte abdecken müssen, kann sie damit im Ergebnis nicht durchdringen.
(a) Es ist schon nichts dafür ersichtlich, dass die Vorlage eines Rammplans notwendige Voraussetzung für die Bestellung der Baumaterialien ist und die Beklagte dementsprechend verpflichtet war, diesen zeitlich vor Auslösung des Lieferauftrages der Spundwandbohlen gegenüber der Firma S. GmbH anzufertigen. Woraus die Klägerin eine solche Verpflichtung herleiten will, trägt sie schon nicht vor. Die Vertragsunterlagen geben hierfür jedenfalls nichts her.
(b) Dass die Erstellung des Rammplanes gemäß Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses eigene Vermessungsleistungen der Beklagten vor Ort erforderte, lässt sich dem Bauvertrag im Hinblick auf Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses ebenfalls gerade nicht entnehmen.
Die Beklagte hat vielmehr zu Recht bereits in erster Instanz darauf verwiesen, dass die Anfertigung des Rammplanes noch keine Veranlassung geboten hat, die Spundwand über den gesamten Trassenverlauf vor Ort einzumessen. Denn ausweislich Ziffer 4.1 des Leistungsverzeichnisses hat der Rammplan “auf der Grundlage der Planungsvorgaben” der Auftraggeber erstellt werden sollen; eigene Vermessungsleistungen des Auftragnehmers waren nach dem zum Vertragsinhalt erhobenen Ausschreibungstext bei der Erstellung des Rammplanes gerade nicht verlangt. Die Beklagte hat danach vielmehr die Längenmaße aus der von der Versicherungsnehmerin der Klägerin vorgelegten Planung und statischen Berechnung zugrunde legen dürfen.
Der von der Klägerin zur Akte gereichte Rammplan (Anlage K 12, Band I Blatt 238 d.A.) lässt im Übrigen ebenfalls nicht erkennen, dass die Beklagte hierfür das Längenmaß der Spundwandbohlen zuvor hätte einmessen müssen. Denn der Rammplan gibt lediglich den konkreten Verlauf der Spundwandtrasse in einem Lageplan und die sog. Rammrichtung wieder, Längsmaße und Querschnitte sind nicht eingezeichnet. An der linken Seite des Plans sind die Koordinaten der Spundwand lediglich entsprechend den planerischen Vorgaben der Auftraggeberin aus dem Leistungsverzeichnis aufgeführt worden. Die zeichnerische Darstellung stützt die Behauptung der Beklagten, dass der Werkplan lediglich zur Lokalisierung des Verlaufs der herzustellenden Spundwand für die vor Ort tätigen Bauarbeiter dient. Dass der Erstellung des Rammplans eine geodätische Vermessung des Geländeniveaus und eigene statische Planung der zu verbauenden Spundwandelemente vorauszugehen hat, geht aus dem vorliegenden Rammplan jedenfalls nicht hervor.
(c) Inwiefern es für die Darstellung des Trassenverlaufs im Rammplan gerade auch einer konkreten Vermessung und Festlegung der Längsmaße der Spundwand durch die Beklagte – unabhängig von den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses und der vorliegenden statischen Berechnung – bedurft habe, hat die Klägerin im Übrigen auch nicht schlüssig darzulegen vermocht. Es wäre Sache der Klägerin gewesen, im Einzelnen vorzutragen, in welchem konkreten Punkt die Beklagte denn unter Berücksichtigung der Vorgaben der Auftraggeberseite in dem Leistungsverzeichnis oder etwa in Abweichung hiervon Planungsfehler begangen haben sollte und inwiefern die fehlerhafte Dimensionierung der von ihr bestellten Spundwandbohlen – trotz Einhaltung der Vorgaben des Leistungsverzeichnisses – gerade auf diesen Fehler bei Erstellung des Rammplans zurückzuführen sein soll. Selbst wenn der Beklagten aber bei Anfertigung des Rammplans ein Planungsmangel unterlaufen sein sollte, besagt dies überdies noch nicht, inwiefern sich dieser Fehler bei der Bestellung der Spundwandbohlen ausgewirkt haben müsste. Anhaltspunkte hierfür sind weder dargetan noch ersichtlich. Einen schadensursächlichen Planungsfehler behauptet die Klägerin vielmehr schon gar nicht. Ihr Vortrag geht in der Sache lediglich dahin, dass die Beklagte bei Gelegenheit der Erstellung des Rammplans eine Ortsbesichtigung hätte vornehmen und hierbei das unterschiedliche Geländeniveau hätte erkennen müssen. Denn sie begründet den vermeintlichen Planungsmangel der Beklagten im Wesentlichen damit, dass die Anfertigung des Rammplans eine Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit durch die Beklagte und eine Überprüfung des Geländeniveaus erfordert hätte. Hierbei hätte die Beklagte feststellen können und müssen, dass die Spundwandbohlen mit durchgängig 2 m Länge zu kurz bemessen worden seien. Soweit aber die Beklagte im Zuge der Erstellung des Rammplans einen Mangel der statischen Berechnung und der Ausführungsplanung der Versicherungsnehmerin der Klägerin hätte feststellen können, hätte dies allenfalls eine Bedenkenanzeigepflicht nach § 4 Nr.3 VOB/B auslösen können, ein von der Beklagten begangener, eigenständiger Planungsmangel bei Anfertigung des Rammplans kann hiermit jedoch nicht begründet werden.
(3) Die Beklagte hat dem Entwässerungsbetrieb der W. im Hinblick auf den festgestellten Mangel der Spundwandelemente letztlich aber auch nicht wegen Verletzung vertraglicher Prüf- und Hinweispflichten nach § 4 Nr. 3 VOB/B einstehen müssen.
Auch wenn die Planungsverantwortung in erster Linie bei der Versicherungsnehmerin der Klägerin lag, da der Mangel auf eine fehlerhafte Statik und Planung der Versicherungsnehmerin der Klägerin zurückgeht, hat der Beklagten als bauausführenden Unternehmens im Hinblick auf den von ihr geschuldeten Werkleistungserfolg eine allgemeine Bedenkenhinweispflicht gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B oblegen (vgl. für die Zeit nach Abnahme: § 13 Abs. 3 VOB/B). Aus der Übernahme der Verantwortung für den Leistungserfolg folgt nämlich eine Prüfungsverpflichtung des Auftragnehmers, zumal der nach § 4 Nr. 3 VOB/B geschuldete Hinweis ohne eine vorherige Prüfung nicht erteilt werden kann.
(a) Wann die der Bedenkenanzeige nach § 4 Nr. 3 VOB/ B denknotwendig vorausgehende Prüfpflicht des Auftragnehmers ansetzt und wie weit sie reicht, hängt von den Umständen und Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls ab. Entscheidende Gesichtspunkte sind das bei dem Auftragnehmer konkret vorauszusetzende Fachwissen, die Art und der Umfang der Leistungsverpflichtung und des Leistungsobjekts sowie die Person des Auftraggebers oder des zur Bauleitung bestellten Vertreters und die Umstände der Vorgaben und Vorleistungen sowie die Möglichkeiten zur Untersuchung (vgl. BGHZ 174, 110; OLG Braunschweig BauR 2016, 2107; OLG Naumburg, Urteil vom 08. Mai 2013, 2 U 174/12, IBR 2014, 732 zitiert nach juris; OLG Brandenburg BauR 2002, 1709; Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil, Rdn. 46 m.w.N.). Bei einem Unternehmer können die zur Herstellung des von ihm geschuldeten Bauwerkes erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten eines Handwerkers der betreffenden Branche erwartet werden. Für das hierzu nötige Wissen und Können muss er grundsätzlich einstehen (vgl. Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil, Rdn. 46 m.w.N.). Die Ausgestaltung der vertraglichen Prüf- und Hinweispflichten hängt weiter davon ab, welcher Pflichtenbereich des Auftragnehmers betroffen ist. So ist die Prüfpflicht am stärksten ausgeprägt hinsichtlich der von dem Auftraggeber bereit gestellten Stoffe und Bauteile, weil gerade auf diesem Gebiet die Sachkenntnis des Auftragnehmers, der üblicherweise selbst die Stoffe und Bauteile bereitstellen und für deren Ordnungsgemäßheit einzustehen hat, am größten ist. Geringer ist der Umfang der Prüfpflicht hinsichtlich der Vorleistung anderer Unternehmer, da diese das Fachgebiet des eigentlichen Auftragnehmers nur dort berühren, wo seine Leistung später unmittelbar aufbaut. Am schwächsten ausgestaltet ist die Prüfpflicht dort, wo es um die vorgesehene Art der Ausführung geht, weil diese grundsätzlich dem Planbereich angehört, in dem der Auftraggeber regelmäßig – wie auch hier – einen eigenen Fachmann, nämlich einen bauplanenden Architekten oder Ingenieur beschäftigt (vgl. OLG Brandenburg BauR 2002, 1709; OLG Naumburg, Urteil vom 08. Mai 2013, 2 U 174/12 zitiert nach juris; OLG Hamm, Urteil vom 28. Januar 2003, 34 U 37/02, BauR 2003, 1052). Zum Pflichtenkreis des Bauunternehmers gehört es dagegen im Regelfall nicht, die Erkenntnisse des bauplanenden Architekten und die Statik zu hinterfragen und auf deren Richtigkeit hin zu überprüfen. Das Bauunternehmen darf sich vielmehr auf die Prüfergebnisse eines Sonderfachmannes verlassen und auf die Richtigkeit der Planvorgaben des planenden Architekten vertrauen, es sei denn, ein Fehler der Planung “springt geradezu ins Auge” (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 15. Januar 2001, 4 U 58/00 zitiert nach juris; OLG Frankfurt, Urteil vom 16. Dezember 2011, 10 U 294/09 zitiert nach juris; OLG Köln NJW-RR 2016, 141; Pastor in Werner / Pastor, Der Bauprozess, 15.Aufl., Rdn. 2043). Dies gilt insbesondere in Bezug auf eine ihm vorgegebene, von einem Statiker als Sonderfachmann erstellte statische Berechnung (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 16. Dezember 2011, 10 U 294/09 zitiert nach juris; OLG Köln NJW-RR 2016, 141).
(b) Im Streitfall betrifft die Hinweis- und Prüfungspflicht, deren Verletzung die Klägerin geltend macht, den Bereich der Art der Ausführung, also einen Sektor, in dem die Prüfungs- und Hinweispflichten des bauausführenden Unternehmers am geringsten ausgeprägt sind.
Die Prüfpflicht geht zwar auch in diesem Bereich generell dahin zu kontrollieren, ob die von der Auftraggeberseite kommende Planung zur Verwirklichung des von dem Auftragnehmer geschuldeten Leistungserfolges geeignet ist (vgl. OLG Brandenburg BauR 2002, 1709; OLG Celle, BauR 2002, 812; OLG Naumburg, Urteil vom 08. Mai 2013, 2 U 174/12 zitiert nach juris; OLG Hamm, Urteil vom 28. Januar 2003, 34 U 37/02, BauR 2003, 1052). Dies gilt aber grundsätzlich nur in den Grenzen des von dem Auftragnehmer übernommenen Leistungsumfangs (vgl. OLG Brandenburg, BauR 2002, 1709). Für eine unterlassene Prüfung und Mitteilung ist er nur verantwortlich, wenn er Mängel mit den bei einem Fachmann seines Gebiets zu erwartenden Kenntnissen ohne größeren Aufwand hätte erkennen können, wobei von ihm nur das dem aktuellen Stand der Technik entsprechende, branchenübliche Normalwissen seines Fachgebietes verlangt wird (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 20. Dezember 2000, 3 U 110/98 zitiert nach juris; OLG Jena BauR 2011, 1173, 1175; Pastor in Werner / Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 2040). Über Spezialkenntnisse der jeweiligen Fachplaner, insbesondere zur Überprüfung der Statik, muss der lediglich bauausführende Unternehmer hingegen nicht verfügen (vgl. OLG Frankfurt IBR 2012, 141; OLG Brandenburg, Urteil vom 20. Dezember 2000, 3 U 110/98 zitiert nach juris; Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 4.Aufl, 6. Teil, Rdn. 46). Die Prüfungspflicht des Auftragnehmers kann unter Umständen sogar entfallen, wenn der Auftraggeber einen Fachplaner oder Bauleiter bestellt hat, bei dem auf dem in Betracht kommenden Gebiet ein gegenüber dem Kenntnisstand des Auftragnehmers höheres Fachwissen vorauszusetzen ist (vgl. OLG Karlsruhe BauR 1972, 380; OLG Hamm BauR 2003, 1052; OLG Celle BauR 2002, 812; OLG Naumburg, Urteil vom 08. Mai 2013, 2 U 174/12 zitiert nach juris).
So liegt der Fall aber auch hier.
Der Entwässerungsbetrieb der W. hat im Streitfall mit der Versicherungsnehmerin der Klägerin einen Sonderfachmann für die Ausführungsplanung und Bauleitung herangezogen, der sich wiederum für die Ausarbeitung der Genehmigungsplanung eines Statikers bediente. Beide Sonderfachleute haben die hier in Rede stehende Problematik des unterschiedlichen Geländeniveaus bei der Bemessung der Länge der Spundwandelemente indessen offensichtlich nicht erkannt.
Auch im Fall der Einschaltung eines Sonderfachmannes ist der bauausführende Werkunternehmer zwar verpflichtet, die Planungsunterlagen im Rahmen seiner eigenen Sachkunde zumindest auf offenkundige Fehler zu überprüfen (vgl. OLG Köln NJW-RR 2016, 141; OLG Bamberg, Urteil vom 20. Dezember 2000, 3 U 110/98 zitiert nach juris; OLG Celle BauR 2002, 812; OLG Brandenburg BauR 2002, 1709; OLG Naumburg, Urteil vom 12. November 2014, 5 U 132/14; Kniffka / Koebele, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl.,6. Teil, Rdn. 46 m.w.N.). Er darf sich auf die Fachplanung mithin nur dann nicht verlassen, wenn deren Lücken und Mängel für ihn aus baufachlicher Sicht evident zutage treten. Das Gleiche gilt auch in Bezug auf eine ihm vorgegebene, von einem Statiker als Sonderfachmann erstellte statische Berechnung. Auch insoweit obliegt es dem bauausführenden Unternehmer im allgemeinen allerdings nicht, die bauherrenseits vorgegebene Statik im Einzelnen nachzuberechnen, es sei denn, der Fehler der Statik “springt regelrecht ins Auge” (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 16. Dezember 2011, 10 U 294/09, IBR 2012, 141; OLG Bamberg, Urteil vom 20. Dezember 2000, 3 U 110/98 zitiert nach juris).
Dafür haben hier indessen keine Anhaltspunkte bestanden. Sie hat die zu verbauenden Spundwandbohlen unstreitig in Übereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis und den sonstigen Vertragsunterlagen vor Beginn der Bauarbeiten beschafft. Die genauen Parameter, die die Spundwandbohlen aufweisen sollten, waren ihr in dem Leistungsverzeichnis konkret vorgegeben worden. Eine Auswahlmöglichkeit war ihr insoweit gerade nicht eingeräumt worden. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass ein Baufachmann wie die Beklagte bei Durchsicht des Leistungsverzeichnisses und der ihr zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen und statischen Berechnungen den Fehler bei der Angabe des Längenmaßes der Bohlen im Rahmen seiner eigenen Fachkunde ohne Weiteres hätte aufdecken können und müssen. Für sie bestand zum Zeitpunkt der Auslösung der Materialbestellung am 28. März 2013 nach Lage der Dinge jedenfalls noch kein besonderer Anlass, die Richtigkeit der Angaben im Leistungsverzeichnis zum Spundwandprofil und deren statischer Relevanz zu hinterfragen und sich mit der zugrunde liegenden statischen Berechnung inhaltlich näher auseinanderzusetzen. Gegen das Vorliegen eines offenkundigen Fehlers, der sich dem bauausführenden Auftragnehmer geradezu aufdrängen musste, spricht im Übrigen bereits, dass die bauplanenden Sonderfachleute, nämlich die Versicherungsnehmerin der Klägerin und der von dieser beauftragte Statiker, ganz offensichtlich ihrerseits bei den angestellten statischen Berechnungen verkannt haben, dass die Spundwandbohlen in manchen Bauabschnitten aufgrund des unterschiedlichen Geländeniveaus mit durchgängig 2 m zu gering bemessen worden sind und der Hochwasserschutz damit nicht über die gesamte Strecke gewährleistet werden kann. Es ist insoweit auch nichts dafür ersichtlich, aus welchem Grunde die Beklagte “klüger” hätte sein müssen oder über bessere Erkenntnisse verfügen sollte als die von dem Entwässerungsbetrieb der W. mit der Planung beauftragten Fachleute (vgl. ähnlich OLG Köln, Urteil vom 06. Dezember 2005, 22 U 72/05 zitiert nach juris).
Der Beklagten kann insbesondere nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie die Bestellung der Spundwandbohlen zeitnah nach Zuschlagserteilung auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung und in Übereinstimmung mit dem Leistungsverzeichnis am 28. März 2013 ausgelöst hat, um den Fortgang der Bauarbeiten angemessen zu beschleunigen, und sie sich dabei auf die vorgegebenen Maßangaben des Leistungsverzeichnisses verlassen hat. Bei Auslösung des Lieferauftrages gegenüber der Firma S. GmbH mussten sich der Beklagten nämlich seinerzeit noch keine Bedenken wegen der Lieferlänge der Spundwahlbohlen aufdrängen. Dass sie die diesbezüglichen Planungsmängel zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt hat, kann ihr hingegen nicht angelastet werden, zumal von ihr hierzu keine Spezialkenntnisse, insbesondere zur Überprüfung der Statik, erwartet werden konnten. Die erforderlichen statischen Berechnungen, die konstruktiven Details der Gründung der Spundwand sowie die Festlegung der Koordinaten der Spundwandbauteile nach Fabrikat, Stahlsorte und Höhenmaß waren vielmehr Aufgabe der Versicherungsnehmerin der Beklagten und deren Subunternehmerin, die diese aufgrund ihrer Fachkunde eigenverantwortlich auszuführen hatten. Es erscheint dem Senat bei dieser Sachlage nicht gerechtfertigt, dass die eigenen planerischen Versäumnisse der Sonderfachleute bei der Vorbereitung des Werkvertrages der Klägerin als bauausführende Unternehmen angelastet werden sollen.
Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang in erster Instanz allerdings behauptet hat, dass die C.-GmbH und der Auftraggeber sie unmittelbar nach Auftragserteilung bereits aufgefordert habe, die Bestellung der Spundwandelemente mit einer Länge von 2 m für das Bauvorhaben sofort auszulösen, um eine kurzfristige Ausführung der Tätigkeiten und einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist dies zwar zwischen den Parteien streitig geblieben. Wie schon das Landgericht in dem angefochtenen Urteil zutreffend festgestellt hat, lässt sich aus der insoweit in Bezug genommenen E-Mail der Versicherungsnehmerin der Klägerin vom 22. März 2013 (Anlage B 3, Band I Blatt 120 d.A.) eine entsprechende Weisung oder Anordnung nicht entnehmen. Angesichts der Produktionsvorlaufzeiten ist es indessen im Interesse der Förderung des Bauablaufs eine sachgerechte und naheliegende Entscheidung gewesen, die Materialbestellung möglichst alsbald auszulösen. Für die Beklagte bestand in diesem frühen Vertragsstadium vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten aber jedenfalls noch kein erkennbarer Grund, an der Richtigkeit der Angaben in dem Leistungsverzeichnis zum Spundwandprofil Zweifel zu hegen. Sie durfte sich vielmehr zu diesem Zeitpunkt bei Auslösung ihrer Bestellung für die erforderlichen Baumaterialien noch darauf verlassen, dass sie die Spundwandbohlen nach dem dort beschriebenen Profil zum Längs- bzw. Höhenmaß bestellen durfte, zumal die Angaben auf der statischen Berechnung eines eigens hierfür eingeschalteten Sonderfachmannes beruhten. Eine Nachberechnung der Längenmaße im Ergebnis einer eigenen Vermessung der Örtlichkeiten konnte ihr in diesem Anfangsstadium der Vertragsausführung nicht angesonnen werden. Denn dies würde im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass man von dem bauausführenden Unternehmer verlangen müsste, vor Beginn der Baumaßnahme und Auslösung der Baumaterialbestellungen nochmals sämtliche Maßangaben und Massen des von Auftraggeberseite vorgegebenen Leistungsverzeichnisses einer erneuten eigenständigen Überprüfung zu unterziehen, wodurch die Fachplanung nebst statischer Berechnung der Sonderfachleute letztlich aber ihre eigentliche Berechtigung verlieren würde. Sie ist aber auch im Rahmen ihrer Prüfungs- und Hinweispflicht aus § 4 Nr. 3 VOB/B nicht verpflichtet gewesen, ihrerseits die Tätigkeit eines bauplanenden Architekten oder Statikers wahrzunehmen und eigene statische Berechnungen zu den Höhenmaßen anzustellen.
Soweit die Versicherungsnehmerin der Klägerin die Beklagte in dem Schreiben vom 22. März 2013 (Anlage B 3, Band I Blatt 120 d.A.) aufgefordert hatte, die tatsächliche Baulänge vor Ort selbst zu ermitteln, um Fehlmengen und Vermessungsungenauigkeiten auszuschließen, rechtfertigt dies keine abweichende Beurteilung. Denn die Aufforderung in dem Schreiben hat sich ersichtlich nicht auf das im Leistungsverzeichnis nach Fabrikat, Stahlsorte und Lieferlänge beschriebene Spundwandprofil bezogen, diese Daten waren der Beklagten vielmehr gerade von dem Auftraggeber im Leistungsverzeichnis vorgegeben worden, sondern auf die für die gesamte Achslänge der Hochwasserschutzanlage entlang der Kläranlage erforderliche Mengen an Bohlen. Wären die Koordinaten der Bauteile auch noch nach dem Längsmaß variabel gewesen und hätte auch die Lieferlänge von dem Ergebnis einer eigenen Vermessung abhängen sollen, dann hätte das Längsmaß nicht in dem Leistungsverzeichnis als feststehend angegeben werden dürfen. Dadurch dass in dem Leistungsverzeichnis zum Spundwandprofil neben dem Fabrikat die Stahlsorte und Lieferlänge vorgegeben ist, hat der Auftraggeber den Leistungsgegenstand für die Beklagte konkret festgelegt, was die Beklagte aber am 28. März 2013 zur Grundlage ihrer Materialbestellung machen konnte.
Nachdem sie die Bauarbeiten vor Ort am 10. Juli 2013 begonnen hatte, hat sie mit Schreiben vom 12. Juli 2013 (Anlage K 5, Band I Blatt 45 d.A.) ihre Bedenken gegen die Ausführungsplanung sogleich zeitnah angemeldet.
(cc) Derselbe Maßstab, der für die Bedenkenanzeigepflicht nach § 4 Nr. 3 VOB/B zugrunde zu legen ist, gilt im Übrigen in gleicher Weise auch für die von der Klägerin aus dem Bauvertrag unmittelbar abgeleiteten vertraglichen Prüfpflichten. Soweit die Klägerin neben den Positionen 3.8 und 4.1 des Leistungsverzeichnisses im Zusammenhang mit der Erstellung des Rammplans unter anderem auch die Positionen 1.1. des Titels 1, Ziffern 1.7 bis 1.10 und Titel 2, Positionen 2.1 bis 2.4 und Titel 3 Ziffer 3.2, 3.3 und 3.7 und 4.1 des Leistungsverzeichnisses zitiert und insoweit die Ansicht vertritt, dass hieraus vertragliche Hinweis- und Kontrollpflichten des Auftragnehmers resultieren, wird jedoch nicht erkennbar, dass die hieraus abgeleiteten Pflichten nach Inhalt und Reichweite über die generell besehende Prüfungspflicht aus § 4 Nr.3 VOB/B hinausgehen könnten. Die bei Ausführung der benannten Leistungspositionen begründeten Prüfpflichten können jedenfalls keineswegs so weit reichen, dass der Unternehmer die bauherrnseitig vorgegebene Statik und Ausführungsplanung im Einzelnen nachrechnen müsste. Denn dies würde letztlich dazu führen, dass praktisch dieselbe Arbeit zweimal erbracht würde und die Ausführungsplanung der Klägerin damit im Ergebnis gegenstandslos würde, was aber vernünftigerweise nicht der Wille der Bauvertragsparteien gewesen sein kann (vgl. ebenso: OLG Frankfurt, Urteil vom 16. Dezember 2011, 10 U 294/09 zitiert nach juris).
Darüber hinaus betreffen die von der Klägerin zitierten Leistungspositionen des Leistungsverzeichnisses, wie beispielsweise Ziffern 2.1 und 2.4 sowie 3.7 des Leistungsverzeichnisses, zum Teil Leistungsabschnitte während der Bauausführung, die die schadenersatzrechtlich hier relevante Untersuchungspflicht vor Aufnahme der Bauarbeiten und Bestellung der Spundwandbohlen schon der Sache nach nicht umfassen können.
Der Senat sieht nach alledem einen Verstoß der Beklagten gegen eine Prüfungs- und Hinweispflicht aus § 4 Nr. 3 VOB/B – in Übereinstimmung mit dem Landgericht – nicht als gegeben an. Da die Beklagte für die fehlerhafte Dimensionierung der von ihr bestellten Spundwandbohlen nicht verantwortlich war, hat sie dem Entwässerungsbetrieb der W. dementsprechend auch keinen Schadensersatz nach § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/B im Hinblick auf die Mehrkosten geschuldet.
cc) Für die Entscheidung des Rechtsstreites kommt es danach im Ergebnis nicht mehr darauf an, ob die Einschätzung des Landgerichts ebenfalls zutreffend ist, dass bei – unterstellter – Annahme einer Verletzung der Bedenkenhinweispflicht aus § 4 3 VOB/B durch die Beklagte ein Innenausgleich nach § 426 Abs. 1 S. 1 BGB bereits wegen des weit überwiegenden Verschuldens der Versicherungsnehmerin der Klägerin an der Entstehung der Mehrkosten für die erneute Bestellung der Spundwandelementen ohnehin ausgeschlossen wäre.
(1) Wie das Landgericht im Ausgangspunkt zutreffend erkannt hat, begründet die in § 426 Abs. 1 S. 1 BGB für den Regelfall vorgesehene Haftung zu gleichen Teilen (Quotierung nach Kopfteilen) nur eine bloße Hilfsregel, die durch vertragliche Vereinbarungen, gesetzliche Anordnungen und eine Bewertung der beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge nach § 254 Abs. 1 BGB modifiziert werden kann. § 426 Abs. 1 S. 1 BGB eröffnet insoweit insbesondere die Möglichkeit zum Innenausgleich unter mehreren Gesamtschuldnern nach den zu § 254 BGB entwickelten Grundsätzen, soweit sich aus dem Innenverhältnis nichts Besonderes ergibt. Entscheidend ist daher im Regelfall in erster Linie das Maß der beiderseitigen Verursachung. Auf ein etwaiges Verschulden kommt es erst in zweiter Linie an. Die insoweit vorzunehmende Abwägung kann zu einer Quotelung, aber auch zur alleinigen Belastung eines Ersatzpflichtigen führen (vgl. BGH VersR 2015, 587 m.w.N.; BGHZ 43, 227; BGHZ 51, 275; Looschelders in Staudinger, BGB, (2017), Rdn. 63 und 65 zu § 426 BGB; Werner / Frechen in Werner / Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 2509).
(2) Der Senat sieht sich in diesem Zusammenhang zu dem Hinweis veranlasst, dass er – insoweit ebenfalls im Einklang mit dem Landgericht – im Rahmen der hier gebotenen Abwägung der beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensanteile den Planungsfehlern und erheblichen Versäumnissen der Versicherungsnehmerin der Klägerin ein deutlich höheres Gewicht beimessen würde als einem etwaigen – unterstellten – Verstoß der Beklagten gegen ihre Bedenkenanzeigepflicht aus § 4 Nr. 3 VOB/B. Auf Seiten der Klägerin ist nämlich besonders zu berücksichtigen gewesen, dass ihre Versicherungsnehmerin die eigentliche Schadensursache für die fehlerhafte Bestellung der falsch dimensionierten Spundwandbohlen gesetzt hat. Denn die Vorgaben aus dem Leistungsverzeichnis gehen auf die fehlerhafte statische Berechnung des von ihr beauftragten Baustatikers zurück, für dessen Verschulden sie nach § 278 Abs. 1 BGB wie eigenes Handeln einzustehen hat. Des Weiteren ist ihr anzulasten gewesen, dass sie den Fehler bei Erstellung des Leistungsverzeichnisses selbst nicht aufgedeckt, sondern die Daten aus der fehlerhaften Statik darin ungeprüft übernommen und damit den Mangel perpetuiert hat. Hinzu kommt, dass der Bauherr der Versicherungsnehmerin der Klägerin auch die Bauaufsicht übertragen hat. Der bauaufsichtsführende Architekt nimmt in der Regel eine herausgehobene Stellung unter den Baubeteiligten ein. Ihm obliegt es, für eine mangelfreie Realisierung des Bauvorhabens zu sorgen. Dazu gehört auch in den durch die Aufgabe vorgegebenen Grenzen die Prüfung der ihm vorgelegten Pläne, ob diese geeignet sind, das Bauwerk mangelfrei entstehen zu lassen. Dass die Haftungsverantwortung weit überwiegend bei der Versicherungsnehmerin der Klägerin als planende und bauaufsichtsführende Architektin liegt (vgl. ebenso: OLG Hamm IBR 2013, 681; Werner / Ferchen in Werner / Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 2495), müsste in einer Haftungsverteilung in jedem Fall angemessen zum Ausdruck kommen. Ob die herausgehobene Stellung der Versicherungsnehmerin der Klägerin im gesamten Bauablauf und die ihr zur Last zu legenden Planungsmängel und Versäumnisse es im vorliegenden Fall rechtfertigen würden, die Mitwirkung der anderen Baubeteiligten im Rahmen der Schadensabwägung gänzlich zurücktreten zu lassen, braucht der Senat aber letztlich nicht zu entscheiden.
Zweiter Teil: Feststellungsantrag zu 2):
1. Der auf Feststellung der Einstandspflicht der Beklagten zu einer Haftungsquote von 50 % gerichtete Antrag zu 2) ist nach § 256 Abs. 1 ZPO zulässig. Insbesondere verfügt die Klägerin über ein rechtsschutzwürdiges Interesse an einer alsbaldigen Feststellung einer Ausgleichspflicht der Beklagten nach § 426 Abs. 1 BGB, zumal die Beklagte einen entsprechenden Anspruch der Klägerin leugnet. Wie das Landgericht in dem angefochten Urteil zu Recht ausgeführt hat, besteht für die Klägerin im Übrigen das Risiko, dass ihre Versicherungsnehmerin von dem geschädigten Auftraggeber zukünftig auch noch auf Ersatz der weiterhin offenen Schadenspositionen in Anspruch genommen wird.
2. Der nach § 256 Abs. 1 ZPO insoweit zulässige Feststellungsantrag ist in der Sache jedoch ebenfalls nicht begründet. Der Senat vermag nicht festzustellen, dass der C.-GmbH wegen der falsch dimensionierten Spundwandbohlen ein Anspruch auf hälftige Haftungsfreistellung gegen die Beklagte aus § 426 Abs. 1 BGB zusteht. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verweist der Senat auf seine obigen Ausführungen zum Klageantrag zu 1).
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision zu dem Bundesgerichtshof ist nicht nach § 543 Abs. 1 ZPO zuzulassen gewesen, da der Rechtssache weder eine grundsätzliche Bedeutung beizumessen ist (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO), noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).
Die Entscheidung über die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 47 Abs. 1 S. 1, 39 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG in Verbindung mit § 3 ZPO.